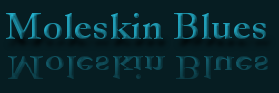Problemstellung
 In bisherigen Arbeiten wurde die Geschichte der New Yorker Intellektuellen unter folgenden Prämissen behandelt:
In bisherigen Arbeiten wurde die Geschichte der New Yorker Intellektuellen unter folgenden Prämissen behandelt:
- Die Geschichte der New Yorker Intellektuellen spielte sich als ein »Coming of Age«-Prozess ab (Alexander Bloom, Terry Cooney)
- Die Geschichte der New Yorker Intellektuellen ist Teil des »literarischen Radikalismus« im frühen 20. Jahrhundert (James Gilbert, Daniel Aaron, Walter B. Rideout)
- Die Geschichte der New Yorker Intellektuellen ist eine Geschichte der »Deradikalisierung« (Alan M. Wald)
- Die Geschichte der New Yorker Intellektuellen ist eine Geschichte des Niedergangs (Howard Brick)
- Die Geschichte der New Yorker Intellektuellen ist eine Geschichte der Institutionalisierung des Modernismus als Ideologie (Hugh Wilford, Serge Guilbaut, Tobias Boes)
- Die Geschichte der New Yorker Intellektuellen ist eine politisch-kulturelle Geschichte der hierarchischen Inbesitznahme und Besitzstandswahrung (John Carey, Paul Gorman et al.)
Zielsetzung
 Meine Herangehensweise verzichtet auf eine monokausale Beschreibung der Entwicklung der Protagonisten als auch auf eine politisch-moralische Beurteilung à la Wald. Es geht nicht um »Narrative« eines »politischen Verrats« oder einer Abkehr vom »wahren« oder »richtigen« Weg, die Wald in seinen Diskussionen immer wieder ins Spiel bringt, sondern um eine demokratische Aufgabe des Intellektuellen (als Gegenpart des »Technikers des praktischen Wissens«), wie sie Sartre beschrieb. Auch in ihrer emphatischen, wenn auch zuweilen diffusen Verkörperung der intellektuellen Rolle in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft bewahrten die New Yorker Intellektuellen (ähnlich wie Adorno) den widerständigen Geist gegen das Getriebe, dem sich die »Akademiker« verschrieben und schließlich mit »Haut und Haaren« überantwortet hatten. In diesem letztlich idealisierten Modell fand schließlich auch der New-Left-Intellektuelle Russell Jacoby in seinem polemisch überspitzten Plädoyer »The Last Intellectuals« seine Angriffsspitzen gegen verkrustete geistigeFunktionärsschichten der Gegenwart.
Meine Herangehensweise verzichtet auf eine monokausale Beschreibung der Entwicklung der Protagonisten als auch auf eine politisch-moralische Beurteilung à la Wald. Es geht nicht um »Narrative« eines »politischen Verrats« oder einer Abkehr vom »wahren« oder »richtigen« Weg, die Wald in seinen Diskussionen immer wieder ins Spiel bringt, sondern um eine demokratische Aufgabe des Intellektuellen (als Gegenpart des »Technikers des praktischen Wissens«), wie sie Sartre beschrieb. Auch in ihrer emphatischen, wenn auch zuweilen diffusen Verkörperung der intellektuellen Rolle in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft bewahrten die New Yorker Intellektuellen (ähnlich wie Adorno) den widerständigen Geist gegen das Getriebe, dem sich die »Akademiker« verschrieben und schließlich mit »Haut und Haaren« überantwortet hatten. In diesem letztlich idealisierten Modell fand schließlich auch der New-Left-Intellektuelle Russell Jacoby in seinem polemisch überspitzten Plädoyer »The Last Intellectuals« seine Angriffsspitzen gegen verkrustete geistigeFunktionärsschichten der Gegenwart.
Hypothesen
 Aus heutiger Sicht – vor allem im Kontext der Diskussion um die rassistische Vergangenheit und Gegenwart der USA – könnte ein klassischer Text wie Philip Rahvs »Paleface and Redskin« aus dem Jahre 1939, der das Selbstverständnis der New Yorker Intellektuellen (nicht zuletzt im Kontext des grassierenden Antisemitismus in New York und in der Welt) geradezu im Stile einer Deklaration artikulierte, nicht mehr widerspruchslos hingenommen werden. Gerade in diesem Text kommt die narzisstische Selbstfixiertheit der New Yorker Intellektuellen zum Ausdruck, während sie für die Gemetzel der Vergangenheit keinen Gedanken erübrigen können. Schon diesem zentralen Text deutete sich die spätere Selbstaufgabe an die »amerikanischen Verhältnisse« der Nachkriegszeit an.
Aus heutiger Sicht – vor allem im Kontext der Diskussion um die rassistische Vergangenheit und Gegenwart der USA – könnte ein klassischer Text wie Philip Rahvs »Paleface and Redskin« aus dem Jahre 1939, der das Selbstverständnis der New Yorker Intellektuellen (nicht zuletzt im Kontext des grassierenden Antisemitismus in New York und in der Welt) geradezu im Stile einer Deklaration artikulierte, nicht mehr widerspruchslos hingenommen werden. Gerade in diesem Text kommt die narzisstische Selbstfixiertheit der New Yorker Intellektuellen zum Ausdruck, während sie für die Gemetzel der Vergangenheit keinen Gedanken erübrigen können. Schon diesem zentralen Text deutete sich die spätere Selbstaufgabe an die »amerikanischen Verhältnisse« der Nachkriegszeit an.
Am Ende geht es nicht um die »Errettung« des Intellektuellen im Jahre 2020 (wie Gérard Noiriel in der Neuausgabe des »Plaidoyer pour les intellectuels« schrieb), sondern um die intellektuelle Verantwortung in universalistischer Perspektive, die als Gegenpol zur Wahrung von Partikularinteressen fungiert. In seiner »wahren« Funktion arbeitet der Intellektuelle auf die eigene Abschaffung hin, um — pathetisch gesprochen – die Menschen zu Intellektuellen der eigenen Existenz zu befähigen. Damit wäre der mutmaßliche geistige Vater der New Yorker Intellektuellen, Leo Trotzki, bestätigt, der in der überschwänglichen Phase nach der Oktoberrevolution
davon schwärmte, »den Grundstein für eine klassenlose, erstmals wahrhaft menschliche Kultur« zu legen (»Literatur und Revolution«, 1923)