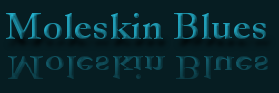»Das hält aus bis zum letzten Seufzer« Ein Rückblick auf das Thomas-Mann-Jahr 2025 von Jörg Auberg In memoriamHanjo Kesting(1943–2025) Thomas Mann: Mario und der Zauberer (Kunsthaus Lübeck, 2004) Als »Amerika« sich für Thomas Mann von der »Lösung« zum »Problem« wandelte, diskutierten er und seine Tochter Erika mit dem linken Filmemacher Abraham Polonsky über ein...