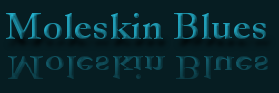Das Elend der Fernsehkritik
Über das Stampfen der Fernsehmaschine
von Jörg Auberg
In einem programmatischen Artikel über die destruktiv-vampirischen Möglichkeiten des Fernsehens aus dem Jahre 1970 konstatierten die Filmkritikerinnen Frieda Grafe und Enno Patalas: »Wir haben bekanntlich das beste Fernsehen der Welt – und deshalb auch das schlechteste Kino.«1 Ziel der Kritik war ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, das sich seine Existenz mit dem »Raubbau am Kino« erkaufte, um ein attraktives Programm Tag um Tag zu gestalten, während das Kino zunehmend in einer »Vampir-Ökonomie« ökonomisch und geistig ausgezehrt wurde.2
Das vampiristische Medium
»Das Fernsehen beutet blindlings aus, was das Kino, Theater, Politik und andere Medien hervorbringen«, dozierten Grafe & Patalas. »Was Fernsehen sein könnte? Dieser Frage versagt sich niemand mehr als das Fernsehen. Selbst unproduktiv, bemächtigt es sich der Filmgeschichte nur, um sie zu verwerten und zu verwursten.«3 In Paraphrase der Dialektik der Aufklärung hätten Grafe & Patalas auch schreiben können: »Ewig stampft die Fernsehmaschine«4. Den Programmmacherinnen attestierten sie nur ein gering entwickeltes Bewusstsein des Mediums jenseits seines vampiristischen und destruktiven Charakters, der sich in der Immergleichheit der Wiederholungen und im Blick in den »Rückspiegel« (rear-view mirrorism) der Mediengeschichte (wie Marshall McLuhan dieses rückwärtsgewandte Verhalten nannte5) erschöpfte.
In einer frühen Studie des kommerziellen US-Fernsehens aus dem Jahre 1953 kam Theodor W. Adorno zu dem Schluss, dass Fernsehen sein Versprechen oder seine Utopie aufgrund der bestehenden ökonomischen Machtverhältnisse bislang nicht realisieren konnte. »Was aus dem Fernsehen werden mag, läßt sich nicht prophezeien«, konstatierte er; »was es heute ist, hängt nicht an der Erfindung, nicht einmal an den besonderen Formen ihrer kommerziellen Verwertung sondern am Ganzen, in welches das Mirakel eingespannt ist.«6
In den späten 1960er und den 1970er-Jahren übernahmen die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten auch die Funktion von Filmproduktionsunternehmen, welche die siechende bundesrepublikanische Filmwirtschaft auf die Rolle des Bittstellers in den bürokratischen Apparaten reduzierten. Ziel war es, wie Torsten Musial in seiner Geschichte der WDR-Fernsehspielabteilung dieser Jahre (unter Berufung auf den WDR-Medienunternehmer Günter Rohrbach) schreibt, den deutschen »Fernsehfilm von seiner muffigen Provinzialität« zu befreien und eine »Filmisierung des Fernsehspiels« zu betreiben, wobei sich der Apparat die kreativen Produktivkräfte von ambitionierten, aufstrebenden Filmtalenten wie Rainer Werner Fassbinder, Edgar Reitz, Rudolf Thome, Klaus Lemke, Hans W. Geißendörfer oder Wim Wenders zunutze machte.7
»Die späten 1960er und die 1970er Jahre waren eine Blütezeit des bundesdeutschen Fernsehspiels«8, lautet die Arbeitsprämisse des Bandes Die Fernsehspielredaktion des WDR 1965–1979: Einsichten in die Wirklichkeit, der die Geschichte der WDR-Fernsehspielproduktion jener Jahre vor allem aus Unternehmersicht wie Rohrbach oder Peter Märthesheimer aufbereitet, die mit ihrer »journalistischen« oder »alltagsrealistischen« Orientierung die TV-Produktion in eine gesellschaftlich anerkannte Strömung drückten, ohne große Experimente in politischer wie technischer Hinsicht zu ermöglichen. Darin drückte sich – mit Orson Welles gesprochen – die »Sparsamkeit des Fernsehens« aus, das »Feind der klassischen filmischen Werte« war, »nicht aber des Films selber«.9
Obgleich beim WDR vorgeblich ein »großes Interesse an den jungen Regisseuren wegen deren neuer Sicht auf das Filmemachen, wegen der gemeinsamen Orientierung an der Nouvelle Vague«10 herrschte, fanden formale Experimente nicht statt. Beispiele für den innovativen Film-Essay in der (selbst-) kritischen Form (wie ihn Jean-Luc Godard in den späten 1960er und in den 1970er-Jahren entwickelt hatte) fand in der Bundesrepublik eher im (international ausgerichteten) Konkurrenzformat Das kleine Fernsehspiel des ZDF statt, wo Godards Weggefährte Jean-Pierre Gorin in seinem Film Routine Pleasures (1986) die Filmkritik Manny Farbers mit der Welt US-amerikanischer Modelleisenbahn-Amateure verknüpfte.11
Die »Legendisierung« der Fernseharbeiter
Eine der prägenden Figuren des bundesrepublikanischen Fernsehspiels war Wolfgang Menge, der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zunächst als Journalist für die neuen Medienkonzerne Springer und Gruner & Jahr arbeitete, ehe er in den Bereich der Film- und Fernseharbeit wechselte. In seiner Menge-Biografie Wer war WM? (die ein Aufguss der »Medienbiographie« Menges aus der Forschungskonferenz »Der Televisionär: Wolfgang Menges transmediales Werk« aus dem Jahr 2016 darstellt12 präsentiert sich der Autor Gundolf S. Freyermuth – ein Gonzo-Veteran des Zeitgeist-Journalismus der 1980er-Jahre – als inniger Freund seines Biografen-Subjekts, der über die Technikbegeisterung seines Freundes Menge von Automobilen (Fiat Balilla und MG TD Midget über Jaguar bis zur Audi-Limousine) bis zu Schreibautomaten von der Kugelkopf-Schreibmaschine oder zu frühen Computern wie DOS-Windows oder Macintosh sich auslässt und immer wieder in den Fokus der eigenen Erzählung rückt.
Für Freyermuth – den neoliberalen Zeitgeistjournalisten aus der postmodernen Phalanx von Transatlantik, Tempo und Stern – ist Menge eine ideologische Projektionsfläche des systemkonformen Journalisten, des Karrieremenschen mit besonderem Interesse für Technik & Kapital und des Parvenüs im bundesrepublikanischen Juste-Milieu, der in Hamburg, Berlin und auf Sylt mit männlicher Deutungshoheit sich durchsetzt, während andere Teile der Familie lediglich als Anhängsel mitgeschleppt werden.13 Die Geschichte von Menge im Umfeld von Springer, Gruner & Jahr, Kracht & Boenisch hätte das Potenzial für eine pynchoneske Medienerzählung mit jenem Geist gehabt, »dessen Vorname ebensogut Zeit wie Polter lauten konnte«14, doch Freyermuth ist zu sehr in die herrschaftlichen Gesetzmäßigkeiten der Medienindustrie involviert, als dass er einen kritischen Blick auf die Mechanismen der kapitalistischen Ökonomie richten könnte.
Symptomatisch ist die Lobhudelei des ehemaligen Tempo-Autors und Literaturverkäufers Denis Scheck, der Menge marktschreierisch als »Jahrhundertgestalt« und »Tausendsassa« charakterisiert15, während Menges reale Film- und Fernsehproduktionen bei der zeitgenössischen Kritik ein eher verhaltenes Echo fanden. Das Jürgen-Roland-Vehikel Unser Wunderland bei Nacht (1959), zu dem (neben anderen Autoren) Menge das Drehbuch beisteuerte, kommentierte der Filmkritiker Dietrich Kuhlbrodt mit den Worten: »In grauem Dilettantismus zerflattert das Debütantenwerk.«16
Autorität und Fernsehen
In jenen Jahren resüssierten Roland und Menge vor allem mit der Adaption der US-amerikanischen Fernsehserie Dragnet, die zwischen 1951 und 1970 eine der erfolgreichsten TV-Shows in den USA war und in der Bundesrepublik unter dem Titel Stahlnetz zwischen 1958 und 1968 lief. Das US-amerikanische Konzept wurde blank auf das bundesrepublikanische Milieu unter Ausblendung der nationalsozialistischen Vergangenheit übertragen. Niemals kommt das polizeiliche »Vorleben« der Kommissare (wie etwa der von Rudolf Platte – der im Nationalsozialismus auch in NS-Propagandafilmen wie Hitlerjunge Quex oder Blutsbrüderschaft mitgewirkt hatte – dargestellte Kriminaloberkommissar Friedrich Roggenburg) in der Zeit von 1933 bis 1945 zum Vorschein. Stets ist der Kommissar Autoritätsfigur, die dem Bösen nachspürt, ohne (mit Erich Fromm gesprochen) die »gesellschaftliche Autoritätsstruktur« (der er selbst entstammt) in den kritischen Blick zu nehmen.17
Roland & Menge betrieben im Restaurationsmilieu der Adenauer-Republik Fernsehunterhaltung mit Mitteln des Polizeistaats. Im Zentrum der Unterhaltungsserie Stahlnetz stehe – zitiert Freyermuth den Regisseur Roland ohne jegliche kritische Hinterfragung – die »Kriminalpolizei und ihr Kampf gegen das Verbrechen«.18
Stahlnetz präsentierte sich immer wieder mit der Behauptung der Authentizität, und Freyermuth kocht die pseudorealistische Suppe mit einer »Stilmischung aus Neorealismus und Film Noir«19 hoch, um das vorgebliche Stilelement des »Voiceover-Kommentars« des Film Noir der dokumentarischen Authentizität der Stahlnetz-Reihe unterzujubeln. »Beide Elemente des Erzählens aus dem Off, die Wirkung des Authentischen und Objektiven wie des Fatalen und Subjektiven«, lobhudelt Freyermuth, »verschmilzt WM in seinen Stahlnetz-Drehbüchern meisterlich.«20 Unterschlagen wird freilich, dass im Voiceover-Kommentar des Film Noir keineswegs lediglich die Handlung vorangetrieben werden sollte, sondern – wie Karen Hollinger konstatierte – eine komplexe Reflexivität in der Realitätswahrnehmung verbalisiert wurde.21
Zudem war die oberflächliche kulturelle Aneignung (oder Indienstnahme) des Film Noir-Stils für deutsche Kriminalfilme eine nochmalige späte Rache an den jüdischen Emigrantinnen (die den »Jewish Emigré Noir« nach ihrer erzwungenen Emigration nach Hollywood begründet hatten), ohne ein Wort über die Shoah und die Verstricktheit vieler Deutscher in die Verbrechen des Nationalsozialismus zu verlieren.22
Auch der spektakuläre Fernsehfilm Das Millionenspiel (1971), der auf der Kurzgeschichte »The Prize of Peril« (1959) des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors Robert Sheckley beruht und später von Yves Boisset unter dem Titel Le prix du danger (1983) verfilmt wurde, transponierte Menge die klassische US-amerikanische Geschichte eines einsamen Helden, der für den Erfolg auch den Tod in Kauf nimmt, auf die deutschen Verhältnisse: Aus Sheckleys Protagonisten Jim Raeder wird bei Menge der Leverkusener Bernhard Lotz (dargestellt als typischer gesellschaftlicher Underdog von Jörg Pleva), der von gedungenen Killern (der »Köhler-Bande«) bis ins Fernsehstudio zum »finalen Rettungsschuss« gejagt wird. Sheckley verarbeitete in seiner Kurzgeschichte die Mechanismen der Kulturindustrie, wie sie bereits Elia Kazan und Budd Schulberg in ihrem Drama A Face in the Crowd (1957) thematisiert hatten.
In Sheckleys Kurzgeschichte ist das Charakteristikum des Gejagten seine Durchschnittlichkeit, die im Fernsehfokus heroisiert wird und im gleißenden Scheinwerferlicht zum »Kultus des Billigen« zerfällt (wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt).23 Die Aura des Billigen umgibt auch den Chef der »Köhler-Bande«, der wie ein schmieriger Krimineller aus französischen B‑Film-Krimis der späten 1960er-Jahre wirkt. Für Raeder ist das Fernsehen (das der Mediensoziologe Todd Gitlin später – in Anklang an den im Kalten Krieg populären Begriff des »militärisch-industriellen Komplexes« – als »Fernseh-Industrie-Komplex«24 bezeichnete), eine Straße zu Ruhm & Reichtum für einen Menschen ohne besondere Talente oder Bildung.25
Während schon bei Sheckley das Fernsehsystem in Gestalt des JBC Network eine bestimmende Rolle in der Erzählung einnimmt, schreibt Freyermuth dem Drehbuchautor Menge ein besonderes Ingenium in der Zeichnung der »futuristischen technischen Basis« des Fernsehfilms zu, die realiter durch die Musik der Musikgruppe Can oder die zeitgeistig-psychedelischen Showeinlagen von abstrakten bunten Massenornamenten einer »rationalen Leerform des Kultes« (die bereits Siegfried Kracauer in seiner Analyse der Massenkultur in den 1920er-Jahren analysierte) zustande kamen.26 Menges Fernsehspiel, behauptet Freyermuth, »überzeichnet den zeitgenössisch einsetzen Prozess der Medialisierung, der Zurichtung des Alltags durch und für die Massenmedien, und macht mit dieser Übertreibung die unscheinbaren Anfänge der entstehenden Zukunft allererst sichtbar«.27 Mit akademischem Halbwissen überhöht der »Professor für Game Studies und (Ko-) Gründungsdirektor des Cologne Game Lab der TH Köln« (wie ihn sein Verlag vorstellt) Menge zum »Televisionär« und das tumbe, unmündige Fernsehpublikum, das im simulierten Mörderspiel nicht die Feinheiten des sensationalistischen Simulakrum verstand.
Freyermuth argumentiert aus der Perspektive eines fetischisierten Technikapparates und bürdet den »Massen« die Schuld dafür auf, dass die mediale Praxis sie erst zu »Massen« macht. Als Privilegierter des Systems wäre es seine intellektuelle Aufgabe, an der Bildung eines kritischen Bewusstseins über die herrschenden Verhältnisse mitzuwirken, woran ihn allerdings seine medial-technizistische Tunnel-Vision hindert. »Dies Bewußtsein wäre zu erwecken«, forderte Theodor W. Adorno 1963, »und dadurch dieselben menschlichen Kräfte gegen das herrschende Unwesen, die heute noch fehlgeleitet und ans Unwesen gebunden sind«.28 Die vorgebliche Gesellschaftskritik der aktuellen Medienpraxis zerfällt in ein zeterndes, aufgemotztes Wabern des Spektakulären im Sinne des »herrschenden Unwesens«, wobei die »perfektionierte Technik« in der Medieninszenierung – wie es bereits in der Dialektik der Aufklärung hieß – »die Spannung zwischen dem Gebilde und dem alltäglich Dasein herabsetzt«29 Damit schlägt die behauptete Medien- und Gesellschaftskritik ins Nichtige um und perpetuiert die herrschenden Verhältnisse in den Apparaten.
Die Verelendung im öffentlich-rechtlichen Prekariat
Tatsächlich förderte das öffentlich-rechtliche Fernsehen (in erster Linie WDR und NDR) trotz der späteren Heroisierung und Legendenbildung kein kritisches Bewusstsein, sondern reproduzierte »die Klassen- und Schichtenstruktur der Gesellschaft«30, wie Franz Dröge in einer Analyse der Produktionsbedingungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens 1973 schrieb. Während sich Wolfgang Menge immer wieder über die schlechte Bezahlung durch öffentlich-rechtliche Sendeanstalten beklagte und trotz allem sich Sportwagen und Residenzen in Berlin oder auf Sylt leisten konnte31, waren »freie« Mitarbeiterinnen in diesem System von prekären Arbeitsbedingungen gebeutelt, wo die Option nur zwischen »Anpassung an den Apparat oder Widerstand aus Koketterie« bestand, wie Harun Farocki – ein Mitglied der Filmkritik-Redaktion und ein »freier« WDR-Mitarbeiter – schrieb. »Rund die Hälfte des Geldes gibt es bei Ablieferung, den Rest bei Sendung und auch dann noch mindestens 14 Tage später. Ohne die Zinsen für zu spät ausgezahlte Honorare hätten alle Sender ein Stockwerk weniger.«32
Der WDR war nicht allein eine »Fernsehfabrik« zwischen Komplizenschaft und Mitschuld, die Farocki in seinen Fernsehfeatures und kritischen Artikeln reflektierte, sondern auch ein Experimentierfeld für filmische Essays in der Tradition von Godard und Adorno.33 Wie Nora M. Alter in ihrer Analyse des Filmwerks Farockis in den 1970er- und 1980er-Jahren konstatierte, verfiel Farocki nie auf autoritäre Voice-Over-Kommentare oder sonstige Interventionen von außen, sondern ließ die Erzählung aus dem Material entstehen.34
Farockis Essayfilme waren – mit Adorno gesprochen – »ein einziger Protest gegen die tödliche Versuchung, es sich leicht zu machen, indem man dem ganzen Glück und der ganzen Wahrheit entsagt. Lieber am Unmöglichen zugrunde gehen.«35 Farocki projektierte ein »anderes Fernsehen«, scheiterte am Ende jedoch an den harten Realitäten des Apparat-Fernsehens. Beispielhaft ist die WDR-Verpflichtung des Nouvelle-Vague-Helden Samuel Fuller für die Tatort-Reihe (Tote Taube in der Beethovenstraße, 1973): »der WDR steht in Köln angefüllt mit der Tristesse gesamtkapitalistischer Informationsproduktion«, kommentierte Farocki. »Die Leute vom WDR sind die Filmbeamten, Fuller setzt immer alles auf eine Karte.«36 Am Ende setzte sich die Lustlosigkeit der Filmbeamten durch, die bis heute ihr Heil im Immergleichen zu finden hoffen.
© Jörg Auberg 2025
Bibliographische Angaben:
Torsten Musial / Martin Wiebel (Hg.).
Die Fernsehspielredaktion des WDR 1965–1979:
Einsichten in die Wirklichkeit.
Reihe »Fernsehen.Geschichte.Ästhetik«, Bd. 7.
München: edition text + kritik, 2025.
239 Seiten, 29 Euro.
ISBN: 978–3‑96707–942‑5.
Gundolf S. Freyermuth.
Wer war WM?
Auf den Spuren eines Televisionärs:
Wolfgang Menges Leben und Werk.
Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2025.
496 Seiten, 29,80 Euro.
ISBN: 978–3‑86599–577‑3.
Nora M. Alter.
Harun Farocki: Forms of Intelligence.
New York: Columbia University Press, 2024.
272 Seiten, 35 US-$.
ISBN: 978–0‑23121–550‑3.
| Bildquellen (Copyrights) |
|
| Beitragsbild |
© edition text + kritik |
| Szenenbild Nosferatu | Wikimedia Commons |
| Intro Das kleine Fernsehspiel | © ZDF |
| Cover Wer war WM? | © Kulturverlag Kadmos |
| Audio »Denis Scheck empfiehlt Wer war WM?« | © WDR |
| Trailer Stahlnetz |
© NDR |
| Trailer Das Millionenspiel |
© WDR |
| Cover Filmkritik |
Archiv des Autors |
| Cover Harun Farocki |
© Columbia University Press |
Nachweise
- Frieda Grafe und Enno Patalas, »Warum wir das beste Fernsehen und deshalb das schlechteste Kino haben«, Filmkritik, Nr. 9 (September 1970), S. 474 ↩
- Der Begriff »Vampir-Ökonomie« geht zurück auf Günter Reimann, The Vampire Economy: Doing Business Under Fascism (1939; rpt. Auburn, AL: Mises Institute, 2014) ↩
- Grafe und Patalas, »Warum wir das beste Fernsehen und deshalb das schlechteste Kino haben«, S. 473 ↩
- Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 5, hg. Gunzelin Schmid Noerr (Frankfurt/Main: Fischer, 1987), S. 175 ↩
- Cf. Elena Lamberty, »Not just a Book on Media: Extending The Gutenberg Galaxy«, in: Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (Toronto: University of Toronto Press, 2011), S. 44 ↩
- Theodor W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft (Gesammelte Schriften, Bd. 10), hg. Rolf Tiedemann (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003), S. 516 ↩
- Torsten Musial, »Wirkliches durchschaubar machen: Zur Geschichte der Fernsehspielabteilung des WDR 1965–1979«, in: Die Fernsehspielredaktion des WDR 1965–1979: Einsichten in die Wirklichkeit, hg. Torsten Musial und Martin Wiebel (München: edition text + kritik, 2025), S. 149 ↩
- Torsten Musial und Martin Wiebel, Vorwort zu: Die Fernsehspielredaktion des WDR 1965–1979, S. 9 ↩
- André Bazin, Orson Welles, übers. Robert Fischer (Wetzlar: Büchse der Pandora, 1980), S. 190 ↩
- Musial, »Wirkliches durchschaubar machen«, S. 149 ↩
- Manny Farber, »The Hidden and the Plain«, in: Farber on Film: The Complete Film Writings of Manny Farber, hg. Robert Polito (New York: Library of America, 2016), S. 775 ↩
- Gundolf S. Freyermuth, »Wolfgang Menge: Authenzität und Autorschaft, Fragmente einer bundesdeutschen Medienbiographie«, in: Der Televisionär: Wolfgang Menges transmediales Werk, hg. Gundolf S. Freyermuth und Lisa Gotto (Bielefeld: Transcript-Verlag, 2016), S. 19–214 ↩
- Kristin Steenbock, Zeitgeistjournalismus: Zur Vorgeschichte deutschsprachiger Popliteratur: Das Magazin »Tempo« (Bielefeld: Transcript-Verlag, 2020), S. 96 ↩
- Thomas Pynchon, Vineland, übers. Dirk van Gunsteren (Reinbek: Rowohlt, 1993), S. 261 ↩
- Steenbock, Zeitgeistjournalismus, S. 111–112; »Denis Scheck empfiehlt ›Wer war WM?‹«, WDR 3, 30. Juni 2025, https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-mosaik/audio-denis-scheck-empfiehlt-wer-war-wm-100.html ↩
- Filmkritik, 3, Nr. 9 (September 1959), S. 235, Filmkritik-Reprint, Bd. 1 (Frankfurt/Main: Zweitausendeins, 1976 ↩
- Erich Fromm et al., Studien über Autorität und Familie: Forschungsbericht aus dem Institut für Sozialforschung (Paris: Librairie Félix Alcan, 1936), S. 145, Reprint »Junius-Drucke« ↩
- Gundolf S. Freyermuth, Wer war WM? Auf den Spuren eines Televisionärs: Wolfgang Menges Leben und Werk (Berlin: Kadmos Kulturverlag, 2025), S. 187 ↩
- Freyermuth, Wer war WM?, S. 185 ↩
- Freyermuth, Wer war WM?, S. 182 ↩
- Karen Hollinger, »Film Noir, Voice-Over, and the Femme Fatale«, in: Film Noir Reader, hg. Alain Silver und James Ursini (New York: Limelight, 2003), S. 244; zur Verwendung des Voiceover-Kommentars in Dokumentarfilmen cf. Bill Nichols, »The Voice of Documentary«, Film Quarterly, 36, Nr. 3 (Frühjahr 1983), S. 17–30; und Bill Nichols, Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary (Bloomington: Indiana University Press, 1991), S. 32–75 ↩
- Cf. Vincent Brook, Driven to Darkness: Jewish Émigré Directors and the Rise of Film Noir (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2009), S. 1–21; und Max Horkheimer, »Alle sind kriminell«, in: Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 6, hg. Alfred Schmidt (Frankfurt/Main: Fischer, 1991), S. 359 ↩
- Robert Sheckley, Store of Infinity (New York: Open Road Integrated Media, 2014), S. 12; Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 5, S. 183 ↩
- Todd Gitlin, Inside Prime Time (Berkeley: University of California Press, 2000), S. 114–200 ↩
- Sheckley, Store of Infinity, S. 12 ↩
- Siegfried Kracauer, Das Ornament der Masse (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1977), S. 61 ↩
- Freyermuth, Wer war WM?, S. 305 ↩
- Theodor W. Adorno, »Kann das Publikum wollen?« (1963), in: Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 20, hg. Rolf Tiedemann (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003), S. 347 ↩
- Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd. 5, S. 153 ↩
- Franz Dröge, »Produktionsbedingungen des Fernsehens in der Bundesrepublik und ihre Konsequenzen für die Programmgestaltung«, Filmkritik, 17, Nr. 9 (September 1973), S. 400 ↩
- Cf. »Günter Gaus im Gespräch mit Wolfgang Menge«, RBB, 14.01.2004, https://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/menge_wolfgang.html ↩
- Harun Farocki, »Notwendige Abwechslung und Vielfalt«, Filmkritik, 19, Nr. 8 (August 1975), S. 369 ↩
- Harun Farocki, »Drückebergerei vor der Wirklichkeit: Das Fernsehfeature – Der Ärger mit den Bildern«, in: Farocki, Meine Nächte mit den Linken: Texte 1964–1975, hg. Volker Pantenburg (Berlin: Neuer Berliner Kunstverein, , 2018), S. 132–139 ↩
- Nora M. Alter, Harun Farocki: Forms of Intelligence (New York: Columbia University Press, 2024), S. 7–8 ↩
- Adorno, Noten zur Literatur, hg, Rolf Tiedemann (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1981), S. 125 ↩
- Farocki, Meine Nächte mit den Linken, S. 128 ↩