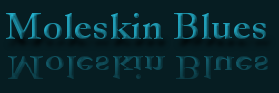Der Fall Silone
Ignazio Silones Rolle im Kampf gegen den Faschismus
von Jörg Auberg
Heiliger, Revolutionär, Verräter
In der pulsierenden Zeit des Kalten Krieges galt Ignazio Silone (1900–1978) bei antistalinistischen Linken in der westlichen Hemisphäre als »säkularer Heiliger«, als der »geliebteste Volksheld der italienischen Linken«, dessen Ruhm und Wahrhaftigkeit sich vor allem aus seiner Abkehr vom Kommunismus begründete, ohne den Sozialismus verraten zu haben.1 In seinen Romanen, schrieb Jürgen Rühle in seinem Standardwerk über die Rolle von Schriftsteller*innen im Kommunismus des 20. Jahrhunderts, »gewann die italienische Linke mit ihrem Antifaschismus, ihrer Verwurzelung im Heimatboden, ihrer eigenwilligen Religiosität und stolzen Unabhängigkeit exemplarische Gestalt«.2 An diesem Mythos arbeitete Silone selbst, als er – in der Bekenntnisanthologie ehemaliger Kommunisten The God That Failed (1950) – darauf insistierte, dass sozialistische Politik nicht an eine partikulare Theorie, sondern an den »Glauben« gebunden sei. Je mehr sozialistische Theorien ihren »wissenschaftlichen« Charakter betonten, umso flüchtiger seien sie; nur sozialistische Werte seien permanent. Auf Theorien könne man eine Schule begründen, insistierte Silone, doch nur auf Basis von Werten könne eine Kultur, eine Zivilisation, eine neue Lebensgrundlage zwischen Menschen aufgebaut werden.3

Für den ehemaligen Trotzkisten und Literaturkritiker Irving Howe, dessen Lebensthema (und Lebenstrauma) das Scheitern des Sozialismus war, verkörperte Silone einen »Heroismus der Ermüdung« in den »dunklen Zeiten« des modernen Europas, »im Herzen unserer Katastrophe«, hatte aber zugleich die »Begabung für Eigensinn«, die ihn über die Bitterkeit und Verzweiflung hinweg half. Für Howe war Silone »der am wenigsten verbitterte Ex-Kommunist, der nachdenklichste Radikaldemokrat« und damit ein Vorbild gegen die blinde Devotion gegenüber überholten Dogmen, auch wenn sie in linksdrapierten Neuverkleidungen erneut unter das Volk gebracht werden sollten.4 Auch wenn in den 1950er-Jahren, der Dekade des »gesellschaftlichen Konformismus«, Silones politische Literatur nicht mehr als »sentimentale Nostalgie« erscheinen mochte, repräsentierte für Howe ein Roman wie Fontamara (1933), obgleich er auf den ersten Blick in der Niederlage endet, trotz allem revolutionäre Hoffnung und einen vitalen Elan, der als Gegenkraft zum antirealistischen Ästhetizismus der beginnenden Postmoderne wirkte. »Silones Romane«, postulierte Howe, »enthalten die tiefgründigste Vision dessen, was Heroismus in der modernen Welt sein kann«.5

In den 1960er-Jahren nahm die Wertschätzung für Silones Prosawerk jedoch merklich ab. Symptomatisch ist die Anthologie des Italien-Liebhabers Klaus Wagenbach (Mein Italien, kreuz und quer), die erstmals 2004 erschien und zwanzig Jahre später in einer aktualisierten Ausgabe neu aufgelegt wurde. Auch wenn in Wagenbachs Verlag Silones Roman Der Fuchs und die Kamelie (1960) 1998 in einer überarbeiteten Übersetzung erschien, in dem – nach Irving Howe – noch einmal der »menschliche Impuls« sich widerspiegelte, der »das Beste im europäischen Sozialismus« repräsentiere6, blieb Silone in einem Querschnitt, der »die Geschichte, die stets gegenwärtige, die Klassenkämpfe, das Trauma des Faschismus, die andauernde Spannung zwischen Selbstentfaltung und dem Gefühl der Fremdbestimmtheit«7 reflektieren soll, außen vor. Der Fokus lag nach Wagenbachs Intention auf der Literatur der italienischen Avantgarde der 1960er-Jahre und danach oder (wie Wagenbach an anderer Stelle schrieb) gegen die »Langeweile des ordentlich gezimmerten neorealistischen Romans«8. Verkörpert wurde diese Richtung der »nachholenden« Modernisierung der italienischen Literatur durch die Gruppe 63, die in Person von Nanni Balestrini, Umberto Eco, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli und anderen Autor*innen der Neo-Avantgarde den »Kampf gegen den kruden und sentimentalen Realismus der damals offiziösen Romanliteratur«9 (wie Wagenbach das Projekt beschrieb) zu organisieren suchten. In seinem programmatischen Essay »Die Literatur als Lüge« stritt Manganelli den Anspruch der Literatur ab, Ausdruck von Moralität zu sein: »Literatur ist unmoralisch«, postulierte er, sei abtrünnig von »jedem solidarischen Gehorsam, jeder Einwilligung ins eigene oder fremde gute Gewissen, jedem mitmenschlichen Gebot«. In erster Linie entschließe sich der Schriftsteller, »unnütz zu sein«. Entgegen der Auffassung der 1930er-Jahre, in der der Literatur eine soziale Verantwortung zugeschrieben wurde, charakterisierte Manganelli die Literatur als »asozial«: »Die Literatur ist anarchisch und folglich eine Utopie: als solche löst sie sich ununterbrochen auf, um neue Form zu gewinnen. Wie alle Utopien ist sie infantil, aufreizend, verwirrend.«10

Mit dem »Spieltrieb« der postmodernen Literatur nach 1945 konnte Silone sich nie anfreunden. »Die alten Legenden und Heiligengeschichten stehen ihm näher als die avancierte zeitgenössische Literatur«11, urteilte der Literaturkritiker Lothar Müller anlässlich des hundertsten Geburtstages Silones. Ähnlich urteilte Alberto Moravia: Silones Werk gehöre zu »einer inzwischen überholten Tradition des italienischen Naturalismus«.12 Für Howe war Silone nicht nur ein Held (wie George Orwell oder Arthur Koestler), sondern ein Meister der moralischen Klarheit »in Momenten von Schwierigkeiten und Solidarität«, auch wenn (wie in Der Fuchs und die Kamelie) sich der moralische Widerstand gegen die Gezeiten der Herrschaft lediglich in Tränen äußert (»Die Tränen wecken keinen Toten wieder auf, aber was soll man sonst tun.«).13 wie sich später – nach Silones Tod – herausstellen sollte, war der »moralische Widerstand« durchaus befleckt, Silones Literatur Ausdruck einer (mit Manganellis Worten) »heroischen, mythologischen Unaufrichtigkeit«, bevölkert mit Heiligen, Revolutionären und Verrätern in einer »Welt ungemildeter Härte und zäher Resignation« (Lothar Müller).14
Silone vor Silone

Am Ende seines Lebens (im Jahre 1978) sagte Silone – dem Schweizer Essayisten François Bondy zufolge – den kryptischen Satz: »Wenn der Faschismus einmal wiederkehrt, wird er nicht so dumm sein zu sagen: Ich bin der Faschismus. Er wird sagen: Ich bin der Antifaschismus.«15 Mittlerweile ist dieser Satz von pseudowissenschaftlichen Leugner*innen der Klimakatastrophe wie dem AfD-nahen »Europäischen Institut für Klima und Energie« usurpiert worden, um öffentlichkeitswirksam Stimmung gegen einen vorgeblichen »grünen Faschismus« zu machen, und auch die AfD selbst funktioniert den Antifaschisten Silone für ihre Zwecke um.16 Dabei blenden die »Zombie-Faschisten«17 (um einen Ausdruck Robert W. McChesneys zu verwenden) sowohl die Vorgeschichte als auch die sozialen und historischen Probleme der menschlichen Entwicklung der Gegenwart wie der Zukunft aus, um ihr reaktionäres Süppchen im Zeitalter der fortschreitenden Regression bekömmlich und schmackhaft über die »(anti-)sozialen« Medien hohnlachend zu vertreiben.18

Entgegen diesen Geschichtsfälschungen muss der abschließende Satz aus Silones Faschismus-Analyse Der Fascismus aus dem Jahre 1934 (vor seiner Karriere als Romanschriftsteller und Sprachrohr des Antikommunismus) in Erinnerung bleiben: »Die Zukunft gehört dem Sozialismus. Die Zukunft gehört der Freiheit.«19 Auf der Frankfurter Buchmesse 2024 rühmte Fabio Stassi, Erfinder des Detektivs und Bibliotherapeuten Vince Corso (»Ich heiße Vince Corso. Ich bin fünfundvierzig, Waise, und verdiene meinen Lebensunterhalt, indem ich Leuten Bücher verschreibe.«20), Silone als den »berühmtesten antifaschistischen Dichter der Welt« und empfahl die Wiederlektüre von Romanen wie Fontamara (1933), der Silones Karriere als Schriftsteller nach seiner politischen Abkehr vom Kommunismus einläutete. Silone sei, lobte ihn Dwight Macdonald in einer Rezension in der trotzkistischen Zeitschrift The New International im April 1939, »ein Intellektueller, ein Mann der Ideen«, der in seinen Analysen des Faschismus und Autoritarismus ein hoch entwickeltes modernes Bewusstsein repräsentierte, während die politische Thematik in seiner Belletristik (wie in Fontamara) »manieriert« bleibe.21

In seinem Buch Bebelplatz erinnert Stassi an die Bücherverbrennung von 1933, als Student*innen in 34 Universitätsstädten in Deutschland über 25.000 Bücher verbrannten, wie Alberto Manguel in seinem Vorwort schreibt: »Bücher werden zur Elegie ihrer selbst, Bibliotheken zu ihren Gräbern.«22 Mit seinem gesellschaftstherapeutischen Ansatz der Literatur wirkt Stassi wie ein später »Sartreaner«, der Literatur als antifaschistisches und demokratisches Projekt, als »Niederfahrt zu den Unterirdischen«23 (Manganelli) begreift. »Die Kunst der Prosa ist mit dem einzigen System solidarisch«, schrieb Jean-Paul Sartre in seinem Essay Was ist Literatur? (1947), »wo die die Prosa einen Sinn behält: mit der Demokratie. Wenn die eine bedroht ist, ist es auch die andere.«24 In seinen Detektivromanen entwirft Stassi mit den fiktionalen Empfehlungen seines Bibliotherapeuten Vince Corso eine »komplexe und grandiose Apologie und Apotheose der Literatur« (Walter van Rossum).25 Als Postscript wählt Stassi ein Zitat Manganellis: »Die Literatur ist Neurose, darum ist von so entscheidender Bedeutung für die Kultur der Moderne, eben weil sie ihr Traum ist, ihr Symptom, ihre Krankheit.«26
Exil als Wendepunkt
Stassi nimmt Silone vor allem als großen Autoren maskuliner Tradition wahr, als einen Schriftsteller, der eine Kategorie von Männern darstelle, für die das Schreiben schwieriger als für andere sei, um ihm anschließend mit Lobhudeleien anderer großer Schriftsteller wie Graham Greene, George Orwell und Albert Camus den Ehrenkranz zu flechten und – mit dem Urteil William Faulkners – zu dem seinerzeit »größten lebenden italienischen Schriftsteller« zu verklären, ohne dass Stassi die exakte Quelle dieses Faulkner-Zitats angibt.27 Während viele italienischen Autor*innen wie Alberto Moravia, Carlo Emilia Gadda, Luigi Pirandello oder Pier Paolo Pasolini sich mit dem faschistischen Regime in Italien arrangierten oder der faschistischen »Bewegung« anschlossen, ging Silone Ende der 1920-er Jahre ins Schweizer Exil. Aufgrund einer schweren Ateminsuffizienz verbrachte er mehrere Monate in Sanatorien in Ascona und Davos und stand als Exilant unter ständiger Beobachtung der Schweizer Behörden, während er sich in seiner prekären Situation mit schlecht bezahlten Tätigkeiten als Schreibkraft, Italienischlehrer, Korrespondent und Übersetzer durchschlug. Neben seiner Lungenkrankheit machte ihm auch die Politik der »Stalinisierung« und seine »Exkommunikation« durch die Kommunistische Partei Italiens (PCI) im Juli 1931 stark zu schaffen.28

Etwas pathetisch schreibt sein Biograf Stanislao G. Pugliese, dass sich Silone im nüchternen Zürich »die Reputation eines einzelgängerischen und sorgenvollen Mannes erwarb, gebrochen an Gesundheit und Geist«, wobei jedoch die Exilerfahrung ihm geholfen habe, sich neu zu erfinden und aus einem Mitglied der Kommunistischen Partei in das zu verwandeln, was Antonio Gramsci in ihm stets gesehen hatte: in erster Linie einen Schriftsteller.29 Mit dem Roman Fontamara über die Politisierung einer Gruppe von Bauern in einem fiktiven Dorf in den Abruzzen schuf er den Grundstein seiner literarischen Karriere, die ihren vorläufigen Höhepunkt in dem Roman Brot und Wein drei Jahre später gewinnen sollte. Eingebettet zwischen diesen beiden Exilromanen war die Analyse des italienischen Faschismus mit dem Titel Der Fascismus, die zwischen den Jahren 1931 und 1934 entstand und von Pugliese als »brutal karges Werk« charakterisiert wird.30 Das Buch erschien 1934 auf Deutsch im Europa-Verlag, womit der engagierte Verleger Emil Oprecht das Schweizer Bürgertum vom totalitären Wesen des italienischen Regimes zu überzeugen versuchte. »Die aufwändige Halblederausgabe gab der Zuversicht von Autor und Verleger Ausdruck«, schreibt Christoph Emanuel Dejung in seiner Oprecht-Biografie, »gebildete Kreise aufzurütteln: Zu Recht waren beide überzeugt, mit ihrer wissenschaftlich fundierten Arbeit den wahren Charakter des von konservativen und katholischen Kreisen verharmlosten Machtsystems Mussolinis aufzudecken.«31
Im Prozess des Zerfalls
Den Aufstieg des italienischen Faschismus leitete Silone aus dem misslungenen Aufbau eines italienischen Staates und dem Verfall der bürgerlichen Gesellschaft. In Anlehnung an Gramsci beschrieb er den Faschismus als Bewegung einer bewaffneten Reaktion, die aus der strukturellen Schwäche Italiens im Zuge der Ereignisse während des Ersten Weltkrieges und der Verwerfungen danach hervorging. Das Scheitern des revolutionären Proletariats führte Gramsci auf politische, organisatorische, taktische und strategische Mängel der Arbeiterpartei zurück. Der Sieg des Faschismus 1922 müsse, führte Gramsci 1926 aus, »nicht als Sieg gesehen werden, der über die Revolution errungen wurde, sondern als eine Konsequenz der Niederlage, welche die revolutionären Kräfte aufgrund ihrer inneren Schwäche erlitten«.32
Immer wieder insistierte Silone, dass der Faschismus weder »vom Himmel gefallen« noch ein Verhängnis, sondern »ein Produkt der Klassenbeziehungen« sei.33 Ähnlich wie in den Analysen der »Frankfurter Schule« ist der Begriff »Staatskapitalismus« eine zentrale Kategorie in der Beschreibung des totalitären Systems (Friedrich Pollock bezeichnete beispielsweise diese Form der Ökonomie als »eine tödliche Drohung für alle Werte der westlichen Zivilisation«34 »Der faschistische Staatskapitalismus hat auf die Mobilisation der wirtschaftlichen Hilfsquellen hingearbeitet, um das Regime zu halten (ein Problem, das die machthabende Klasse beschäftigt und verfolgt). Durch ihn hat das Regime eine Atempause gewonnen, er hat in gewissem Maße den Prozeß des Zerfalls der italienischen Wirtschaft und die Panik der Bourgeoisie vor den immer wachsenden Schwierigkeiten auf diesem Gebiet hinausgeschoben.«35
Für Pugliese ist Silones Faschismus-Analyse das letzte Überbleibsel aus seiner »Parteimentalität«, in Anwendung einer strikten marxistischen Methodologie und in einem polemischen Ton.36 Dabei verkennt er jedoch Silones analytische Leistung in der »Entlarvung« des faschistischen Systems, das vorgeblich eine »neue Welt« schaffen wollte, dabei jedoch lediglich die Ruinen des bürgerlichen Systems neu ordnete, während die Arbeiterbewegung im Widerstand gegen das totalitäre System weitgehend versagte. »Die politische Unreife der Arbeiterbewegung«, urteilte Silone scharf, »hat in der Nachkriegszeit das Kleinbürgertum auf den Kapitalismus gestoßen und dem Sieg des Fascismus geholfen.«37

Der politische Gebrauchswert von Silones Analyse war in der akuten Lage der totalitären Bedrohung offensichtlicher als in späteren Jahren der politischen »Entspannung«. Vor allem Daniel Guérins Markstein in der antifaschistischen Diskussion der 1930er-Jahre – Fascisme et grand capital (1936) – griff in der Diskussion des italienischen Faschismus immer wieder auf Silones Werk zurück, etwa in der Beschreibung der faschistischen Agrarpolitik, die entgegen der Ankündigungen Mussolinis und seiner Satrapen den Kapitalismus in den agrarischen Regionen Italiens zugunsten der Großgrundbesitzer rekonstituierte.38 Guérins Analyse gehörte neben Silones politischer Satire Die Schule der Ditaktoren (1938) zu den Standardtexten der Diskussion um Staatskapitalismus und bürokratischen Kollektivismus im Faschismus und Stalinismus in den frühen 1940er-Jahren.39 Silones engagierter Verleger Oprecht sah sich vor allem durch das sechste Kapitel, in dem Silone die faschistische »Eroberung des flachen Landes« beschrieb, in seiner Hoffnung auf eine antifaschistische Zukunft bestärkt. »Silone gelingt es«, schreibt der Oprecht-Biograf Dejung, »das Geschehen der Machtergreifung als historisches Ereignis detailgetreu und mit eindrücklicher Sachlichkeit zu schildern, ohne ideologische Klischees zu bemühen.«40.
Amerika in den Abruzzen
Selbst vierzig Jahre später wird Silones Analyse noch eine authentische Seriosität zugestanden. Im Nachwort zum Reprint von Silones Faschismus-Analyse aus dem Jahre 1978 im Verlag Neue Kritik empfahl der Herausgeber, der Sozialwissenschaftler Christian Riechers (1936–1993), neben der Lektüre von Silones Werk auch dessen Roman Fontamara zur Kenntnis zu nehmen, in dem sich der »Widerstand der armen Bauern gegen den ›modernen‹ Kapitalismus« artikulierte, der »unter dem Faschismus seinen Einzug in Gebiete hält, die bis data von gemütlich-bestialisch patriarchalischen Ausbeutungsverhältnissen bestimmten waren«.41 In der fiktiven Romanwelt Fontamaras herrscht eine extreme Hierarchie: An der Spitze stehen Gott und der Fürst Torlonia, und bis nach unten ist es ein langer Weg. Nach den Hunden der Aufseher des Fürsten kommt nichts, »immer noch nichts«, »immer noch nichts« , bis schließlich am Ende die »Cafoni«, mittellose Kleinbauern, erscheinen, während in den Zwischenstufen »die Behörden« angesiedelt sind, die vor den »Cafoni« warnen: »Laßt sie nicht herein. Nachher haben wir das ganze Rathaus voller Läuse.«42

Die Gegenkraft zu den mittellosen Bauern ist »der Unternehmer«, der in den Abruzzen mit Techniken des Großkapitals und der faschistischen Bürokratieagenturen »Amerika« für sich und seine Interessen entdecken kann. »Die Cafoni müssen über den Ozean«, sagt eine Stimme im Roman, »um nach Amerika zu gelangen … aber dieser Räuber hat es wirklich hier entdeckt.«43 In der Imagination war »Amerika« – mit den Worten Italo Calvinos – wie ein mythisches Gegenbild, eine »Utopie, eine gesellschaftliche Allegorie, die mit dem in Wirklichkeit existierenden Gebilde gleichen Namens kaum etwas gemeinsam hat«. Für die eine wie die andere Seite war »Amerika« der »Inbegriff für alle Möglichkeiten und Wirklichkeiten der zeitgenössischen Welt«, eine »verworrene Synthese alles dessen, das der Faschismus negieren und ausschalten wollte«.44
Dazu gehört auch die »Demokratie« in Fontamara, die durch Manipulation und Korruption aufrechterhalten wird. Als viele »Cafoni« gegen den amtierenden Bürgermeister stimmen, da er allzu offen die Unternehmer unterstützt, wird die dominierende Position der herrschenden Funktionäre durch die Stimmen von »Lebendig-Toten« in einer demokratischen Farce gesichert. Am Ende erheben und organisieren sich die »Cafoni«: »Nach soviel Leiden und soviel Kämpfen, nach soviel Ungerechtigkeiten, soviel Tränen und soviel Verzweiflung, was tun?«45 Wie Elizabeth Leake schreibt, ist Fontamara die Fiktionalisierung des Gramscianischen Projekts der »organisatorischen Funktion der Hegemonie über die Gesellschaft«, in dem sich eine Gruppe der »Niederen« aus der Stasis mobilisieren, um grundlegende Veränderungen in der Politik ihrer Gedanken und Aktionen herbeizuführen.46
Furcht und Elend im Faschismus
Silones Reputation als Antifaschist wurde stark beschädigt, als im Jahre 2000 zwei jüngere Historiker – Dario Biocca and Mauro Canali – anhand von Dokumenten im Archiv der italienischen Geheimpolizei OVRA (Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo) den antifaschistischen Autoren als mutmaßlichen Polizeiinformanten in den Jahren zwischen 1919 und 1931 enttarnten.47 Die Beweislage war jedoch keineswegs eindeutig, da Informanten stets von ihren Auftraggebern unter Decknamen geführt werden und Silone seine vorgeblichen Berichte keineswegs unter seinem Klarnamen an die faschistische Dienststelle übermittelte. Für den Silone-Verteidiger Fabio Stassi ist die Lage eindeutig: In seinen Augen ist der Versuch, Silone als faschistischen Spion zu geißeln, nicht allein faktisch unbegründet, sondern auch ein niederträchtiges Unterfangen, einen aufrechten Mann, der Zeit seines Lebens wegen seines Nonkonformismus verfolgt wurde, auch posthum zu beschädigen.48
Allerdings ist die Sachlage nicht so einfach, wie Stassi sie darstellt. Historiker wie John Foot oder der renommierte Übersetzer William Weaver sehen den Verdacht, Silone habe als Informant für die italienische Geheimpolizei aus unterschiedlichen Motiven gearbeitet, als durchaus begründet an.49 Dagegen hinterfragt Silones Biograf Pugliese die Glaubwürdigkeit der Beschuldigungen: Warum sollte das faschistische Regime mit Informationen über seinen Informanten Silone, als er zu einem prominenten Akteur in den antifaschistischen Bewegungen in Europa und in den USA aufstieg, hinter dem Berg halten?50

Zugleich thematisierte Silone in seinen antifaschistischen Romanen auch immer die Existenz von Spitzeln, die Furcht vor der Entdeckung, dem Verfallen der Schande des Verrats. In Brot und Wein (1936) kehrt beispielsweise der Sozialist Pietro Spina aus seinem Exil unter dem Deckmantel eines Priesters in die Abruzzen zurück, um dort revolutionäre Zellen zu organisieren. Die Klandestinität ist der Humus, auf dem der Verrat gedeiht. »Das Leben einer geheimen Organisation in einem der Diktatur unterstellen Land«, heißt es an einer Stelle im Roman, »ist fortwährend beherrscht von einem blinden Kampf gegen die Polizeispitzel.«51 Zu den Spitzeln gehört der mittellose Student Luigi Murica, der wegen seiner Mitgliedschaft in einer revolutionären Gruppe verhaftet wird und sich als Spitzel verdingt. Anfangs liefert er lediglich scheinbar unbedenkliche Information, verstrickt sich jedoch immer tiefer in die Informantentätigkeit, bis er von der Furcht vor Entdeckung und der zermürbenden Reue über seinen Verrat zerrieben wird und nach einer neuerlichen Verhaftung an den Misshandlungen im Gefängnis stirbt. Während die Diktatur den Prozess der Entmenschlichung und das Elend der Angst perpetuiert, bleibt die Emanzipation von Angst auch das Ziel des Spitzels. »Die Revolution ist ein Bedürfnis«, erklärt Murica, »nicht mehr allein zu sein, einer gegen den anderen. Sie ist ein Versuch, gemeinsam zu leben und nicht mehr Angst zu haben. Ein Bedürfnis nach Brüderlichkeit.«52
Für viele Kritiker Silones, die von seiner »Schande«, Informant der italienischen Geheimpolizei zu sein, überzeugt waren oder sind, offenbarte der vorgebliche heroische Kämpfer gegen den Faschismus seine Spitzelexistenz in der Figur von Murica.53 Zugleich könnte sich der reale Autor in der gebrochenen Figur des Pietro Spina reflektieren, der in der Tarnung die Herrschaft über die eigene reale Existenz verliert. »Die Angst, irrsinnig zu werden, bemächtigt sich seiner«, schreibt Silone in Brot und Wein. »Er muß sich seinen Namen, seinen richtigen, wiederholen, muss alles verstecken, was zu seiner Verkleidung als Priester gehört, muß sein Knie, seine Schultern, sein Gesicht betasten, sich in die eigene Hand beißen, muß in seiner körperlichen Realität einen Punkt des äußersten Widerstandes gegen seine geistige Verwirrung suchen.«54 Dass Silone unter einer Persönlichkeitsstörung in den frühen 1930er-Jahren litt, behaupten Biocca und Canali in ihrer Studie und geben als Faktum an, Silone habe sich in der Schweiz einer Psychoanalyse bei C. G. Jung unterzogen, obwohl es dafür keinen konkreten Beweis gibt.55
Die Verurteilung Silones basiert nicht auf Beweisen, sondern lediglich auf Indizien. Ähnlich wie zuletzt bei Siegfried Unselds Enttarnung als NSDAP-Mitglied wird »das Archiv« (das von staatlichen Bürokratien betrieben und aufrecht erhalten wird) zum alleinigen Bewahrer der historischen Wahrheit. Im Falle von Silone ist die Quelle der Ermittlung das Überbleibsel von geheimpolizeilichen Aktivitäten, die in ein Archiv überführt wurden, ohne den Prozess der Entstehung einzubeziehen. Wie Pugliare (mit einem Hinweis auf Jacques Derridas Schrift Dem Archiv verschrieben aus dem Jahre 1995) in seiner Verteidigung Silones ausführte, ist das Archiv ein Ort, wo Erinnerung, Geschichte, Fiktion, Technologie, Macht und Autorität ineinander wirken.56 »Die Archivierung bringt das Ereignis in gleichem Maße hervor, wie sie es aufzeichnet«, schrieb Derrida. »Das ist auch unere politische Erfahrung mit den sogenannten Informationsmedien.«57 So ist das »Archiv« keineswegs der Hort einer unumstößlichen Wahrheit, sondern eine »interessengesteuerte« Rekonstruktion der Vergangenheit.
© Jörg Auberg 2025
Für Übersetzungen aus dem Italienischen wurde die Software FlexiPDF NX/DeepL verwendet.
Bibliografische Angaben:
Fabio Stassi.
Bebelplatz: La notte dei libri bruciati.
Mit einem Vorwort von Alberto Manguel.
Palermo: Sellerio Editore, 2024.
312 Seiten, 16 Euro.
ISBN: 978–8‑838947–21‑6.
Fabio Stassi.
Die Seele aller Zufälle.
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki.
Karlsruhe: Edition Converso, 2024.
288 Seiten, 24 Euro.
ISBN: 978–3‑949558–30‑6.
Klaus Wagenbach.
Mein Italien, kreuz und quer.
Aktualisierte und erweiterte Ausgabe letzter Hand.
Berlin: Wagenbach, 2024. WAT [827].
400 Seiten. 18 Euro.
ISBN: 978–3‑8031–2827‑0.
| Bildquellen (Copyrights) |
|
| Beitragsbild (Silone-Collage) |
© Jörg Auberg |
| Cover Decline of the New | © Victor Gollancz |
| Cover Mein Italien, kreuz und quer | © Verlag Klaus Wagenbach |
| Cover Der Fuchs und die Kamelie | © Verlag Klaus Wagenbach |
| Cover Nazi-German in 22 Lessons | © Favoritenpresse |
| Video Fabio Stassi auf der Frankfurter Buchmesse 2024 (Ausschnitt) |
© Edition Converso |
| Cover Bebelplatz |
© Sellerio Editore |
| Cover Die Seele aller Zufälle |
© Edition Converso |
| Cover Der Fascismus |
© Verlag Neue Kritik |
| Cover Sur le fascisme |
© La Découverte |
| Cover Fontamara |
© Büchergilde Gutenberg |
| Cover Brot und Wein | © Büchergilde Gutenberg |
Nachweise
- Elizabeth Leake, The Reinvention of Ignazio Silone (Toronto: University of Toronto Press, 2003), S. 3–4 ↩
- Jürgen Rühle, Literatur und Revolution: Die Schriftsteller und der Kommunismus in der Epoche Lenins und Stalins (Frankfurt/Main: Büchergilde Gutenberg, 1987), S. 402 ↩
- Ignazio Silone, in: The God That Failed, hg. Richard Crossman (1950; erw. New York: Columbia University Press, 2001), S. 114 ↩
- Irving Howe, Politics and the Novel (1957; rpt. Chicago: Ivan R. Dee, 2002), S. 226; Irving Howe, Decline of the New (London: Victor Gollancz, 1971), S. 280; Maurice Issermann, If I Had a Hammer …: The Death of the Old Left and the Birth of the New Left (New York: Basic Books, 1987), S. 80 ↩
- Howe, Politics and the Novel, S. 219, 223, 226; Howe, »Mass Society and Postmodern Fiction«, Partisan Review, 26, Nr. 3 (Sommer 1959):420–436, rpt. in: Decline of the New, S. 190–207 ↩
- Howe, Decline of the New, S. 292 ↩
- Klaus Wagenbach, Nachwort zu: Mein Italien, kreuz und quer (Berlin: Wagenbach, 2024), S. 370 ↩
- Buchstäblich Wagenbach – 50 Jahre: Der unabhängige Verlag für wilde Leser (Berlin: Wagenbach, 2014), S. 26 ↩
- Klaus Wagenbach, Nachwort zu: Giorgio Manganelli, Lügenbuch (Berlin: Wagenbach, 2000), S. 152 ↩
- Manganelli, Lügenbuch, S. 135–137 ↩
- Lothar Müller, »Das Schlagen der Pedale des Webstuhls – Christ ohne Kirche, Sozialist ohne Partei: Zum hundertsten Geburtstag von Ignazio Silone«, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. April 2000, Literaturbeilage, S. iv ↩
- Alberto Moravia und Alain Elkann, Vita di Moravia: Ein Leben im Gespräch, übers. Ulrich Hartmann (Freiburg: Beck & Glückler, 1991), S. 360 ↩
- Howe, Decline of the New, S. 292–293; Ignazio Silone, Der Fuchs und die Kamelie, übers. Hanna Dehio, rev. Marianne Schneider (Berlin: Wagenbach, 1998), S. 140 ↩
- Manganelli, Lügenbuch, S. 142; Müller, »Das Schlagen der Pedale des Webstuhls«, S. iv ↩
- Silone, zit. in: Rühle, Literatur und Revolution, S. 404 ↩
- Fred F. Frey, »Der grüne Faschismus hinter dem ›Weltrettungs‹-Getue«, https://eike-klima-energie.eu/2022/12/09/der-gruene-faschismus-hinter-dem-weltrettungs-getue/; siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f%C3%BCr_Klima_und_Energie; Christian R. Schmidt, »Silones Warnung«, jungle.world, Nr. 5 (2020), https://jungle.world/artikel/2020/05/silones-warnung; Mariam Lau, »Die AfD regiert indirekt längst mit«, Die Zeit, 30. Juni 2024, https://www.zeit.de/politik/deutschland/2024–06/afd-parteitag-essen-parteivorsitz-demonstrationen/komplettansicht ↩
- Robert W. McChesney, Vorwort zu: John Bellamy Foster, Trump in the White House: Tragedy and Farce (New York: Monthly Review Press, 2017), S. 8 ↩
- Theodor W. Adorno, Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1987), S. 268; Siva Vaidhyanathan, Anti-Social Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy (New York: Oxford University Press, 2018); Andrew Marantz, Antisocial: How Online Extremist Broke America (London: Picador, 2020) ↩
- Ignazio Silone, Der Fascismus (Zürich: Europa-Verlag, 1934; rpt. Frankfurt/Main: Verlag Neue Kritik, 1978), S. 285 ↩
- Fabio Stassi, Die Seele der Zufälle, übers. Annette Kopetzki (Karlsruhe: Edition Converso, 2024), S. 9 ↩
- Dwight Macdonald, »School for Dictators«, The New International, 5, Nr. 4 (April 1939), S. 126–127 ↩
- Alberto Manguel, Vorwort zu: Fabio Stassi, Bebelplatz: La notte dei libri bruciati (Palermo: Sellerio Editore, 2024, ePub-Version), S. 9 ↩
- Giorgio Manganelli, Manganelli furioso: Handbuch für unnütze Leidenschaften, übers. Marianne Schneider (Berlin: Wagenbach, 1985), S. 127 ↩
- Jean Paul Sartre, Was ist Literatur?, Schriften zur Literatur, Bd. 2, hg. und übers. Traugott König (Reinbek: Rowohlt, 1987), S. 54; original: Sartre, Situations III, erw. Neuausgabe, hg. Arlette Elkaïm-Sartre (Paris: Gallimard, 2013), S. 64 ↩
- Walter van Rossum, Sich verschreiben: Jean-Paul Sartre, 1939–1953 (Frankfurt/Main: Fischer, 1990), S. 170; siehe auch Lothar Baier, Was wird Literatur? (München: Kunstmann, 2001), S. 54 ↩
- Stassi, Die Seele der Zufälle, S. 271 ↩
- Stassi, Bebelplatz, S. 122 ↩
- Detaillierte Informationen zu Silones Erfahrungen im Schweizer Exil finden sich in: Deborah Holmes, Ignazio Silone in Exile: Writing and Antifascism in Switzerland, 1929–44 (New York: Routledge, 2016, ePub-Version); und Stanislao G. Pugliese, Bitter Spring: A Life of Ignazio Silone (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009, ePub-Version), S. 110–160. Zur Attraktion des Faschismus für Autoren wie Pasolini cf. Simona Bondavelli, Fictions of Youth: Pier Paolo Pasolini, Adolescence, Fascisms (Toronto: University of Toronto Press, 2015) ↩
- Pugliese, Bitter Spring, S. 114; Leake, The Reinvention of Ignazio Silone, S. 3–4 ↩
- Pugliese, Bitter Spring, S. 126 ↩
- Christoph Emanuel Dejung, Emil Oprecht: Verleger der Exilautoren (München: Europa Verlag, 2023, ePub-Version), S. 133 ↩
- Antonio Gramsci, »The Italian Situation and the Tasks of the PCdI« (Lyon-Thesen), in: The Antonio Gramsci Reader: Selected Writings 1916–1935, hg. David Forgacs (London: Lawrence and Wishart, 1999), S. 147 ↩
- Silone, Der Fascismus, S. 273 ↩
- Friedrich Pollock, Stadien des Kapitalismus, hg. Helmut Dubiel (München: C. H. Beck, 1975), S. 72 ↩
- Silone, Der Fascismus, S. 209 ↩
- Pugliese, Bitter Spring, S. 126 ↩
- Silone, Der Fascismus, S. 285 ↩
- Daniel Guérin, Sur le fascisme: La peste brune – Fascisme et grand capital (Paris: La Découverte, 2001), S. 408–409 ↩
- Cf. Michael Wreszin, A Rebel in Defense of Tradition: The Life and Politics of Dwight Macdonald (New York: Basic Books, 1994), S. 72–73; Jörg Auberg, New Yorker Intellektuelle: Eine politisch-kulturelle Geschichte von Aufstieg und Niedergang, 1930–2020 (Bielefeld: transcript, 2022), S. 135–139 ↩
- Dejung, Emil Oprecht: Verleger der Exilautoren, S. 133 ↩
- Christian Riechers, Die Niederlage in der Niederlage: Texte zu Arbeiterbewegung, Klassenkampf, Faschismus, hg. Felix Klopotek (Münster: Unrast Verlag, 2009), S. 295 ↩
- Ignazio Silone, Fontamara, übers. Hanna Dehio (Frankfurt/Main: Büchergilde Gutenberg, 1963), S. 32, 40 ↩
- Silone, Fontamara, S. 53 ↩
- Italo Calvino, Vorwort zu: Cesare Pavese, Schriften zur Literatur, übers. Erna und Erwin Koppen (Hamburg: Claassen, 1967), S. 9–10 ↩
- Silone, Fontamara, S. 215 ↩
- Antonio Gramsci, Marxismus und Kultur: Ideologie, Alltag, Literatur, hg. und übers. Sabine Kebir (Hamburg: VSA-Verlag, 1983), S. 62; Leake, The Reinvention of Ignazio Silone, S. 92 ↩
- Dario Biocca und Mauro Canali, L’informatore: Silone, i comunisti e la Polizia (Mailand: Luni Editrice, 2000); zum Hintergrund siehe Pugliese, Bitter Spring, S. 279–308 ↩
- Stassi, Bebelplatz, S. 122 ↩
- John Foot, Blood and Power: The Rise and Fall of Italian Fascism (London: Bloomsbury, 2022, ePub-Version), S. 194–196; William Weaver, »The Mystery of Ignazio Silone«, New York Review of Books, 49, Nr. 4 (14. März 2002), https://www.nybooks.com/articles/2002/03/14/the-mystery-of-ignazio-silone/ ↩
- Pugliese, Bitter Spring, S. 290 ↩
- Ignazio Silone, Brot und Wein, übers. Adolf Saager (Zürich: Büchergilde Gutenberg, 1936), S. 280 ↩
- Silone, Brot und Wein, S. 307 ↩
- Pugliese, Bitter Spring, S. 287 ↩
- Silone, Brot und Wein, S. 95 ↩
- Holmes, Ignazio Silone in Exile, S. 38 ↩
- Pugliese, Bitter Spring, S. 281–282 ↩
- Jacques Derrida, Dem Archiv verschrieben, übers. Hans D. Gondek und Hans Naumann (Berlin: Brinkmann und Bose, 1997), S. 35 ↩