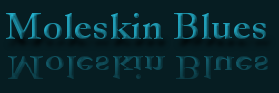Rückfall in die Barbarei
Zygmunt Baumann, Oliver Nachtwey, Volker Weiß, Jan-Werner Müller und Claus Leggewie beleuchten verschiedene Aspekte der autoritären und populistischen Tendenzen in Europa.
von Jörg Auberg
Braun kehrt zurück

Aus den Kloaken der Zeit kehren die kopflosen modrigen Kadetten der exterministischen Destruktion in die Gegenwart zurück. Da ihnen in der Vergangenheit die totale Zerstörung nicht gelang, starten die untoten Wiedergänger einen neuerlichen Versuch, die Welt ins verwesende Miasma des nationalistischen und völkischen Grauens zu zerren. Zur Hölle wird die Geschichte, schrieb Adorno in seinen »Aufzeichnungen zu Kafka«, »weil das Rettende versäumt ward«, und diese Hölle hatte das »späte Bürgertum« selbst eröffnet.1
Stets nehmen sich die scheinbar Zukurzgekommenen in ihrer gesellschaftlichen Ohnmacht als Opfer verschwörerischer, dämonischer Kräfte wahr, die jedoch ausschließlich auf einer pathischen Projektion beruhen. An den realen Verhältnissen sind immer »die anderen« schuld – nie sie selbst. Als Urheber des Unbills, den sie erleben (aber nicht erfahren), suchen sie Sündenböcke unterschiedlicher Herkunft und Couleur aus, die zum Zielpunkt ihres kollektiven Narzissmus und schließlich ihrer Paranoia werden. Im von Ressentiments aufgeladenen Zerrbild eines amorphen Feindes lebt die umfassende Herrschaft fort, das die »Wutbürger« anzugreifen vorgeben. Zu einer kritischen Selbstreflexion, die auch eine Einsicht in die eigene Verstrickung in die realen Verhältnisse einschlösse, sind sie zu keinem Zeitpunkt fähig. Stattdessen triumphiert das (im Wortsinn) »schlagfertige« Kollektiv der allseitigen Bescheid- und Besserwisser mit seiner brüllenden Sprache der Eingesperrten, denen geschichtliche Erfahrung fremd ist.2
Die Angst vor den Anderen
Der Aufschwung der reaktionären Tendenzen in Europa hatte seine Ursache unter anderem in der massenhaften Zuwanderung von Immigranten aus »gescheiterten Staaten« im arabischen und afrikanischen Raum in Folge der verschiedenen Spielarten der Machtpolitik und des Terrorismus nach den Ereignissen des 11. September 2001. Die Aufstände gegen autokratische Machthaber in diesen Staaten führten nicht wie erhofft zu einer demokratischen Neuordnung, sondern hatten unerbittliche Kriege zwischen den verfeindeten Rackets in den jeweiligen Regionen zur Folge, unter denen vor allem die Zivilbevölkerungen zu leiden hatten.

In Europa galten die Flüchtlinge, die ihre bloße Existenz über das Mittelmeer retten konnten, als »Boten des Unglücks«, wie Zygmunt Baumann in seinem letzten Buch Die Angst vor den anderen in Anlehnung an Bertolt Brecht schrieb. Die Masse der Flüchtlinge rief bei den Europäern in ihrer Mehrheit eine diffuse Angst hervor, da sie sich von den Neuankömmlingen in der Sicherheit ihrer Existenz bedroht fühlten. In Zeiten globaler Prozesse flüchtete sich die Majorität der Europäer in realitätsferne und reaktionäre Patentlösungen wie Abschottung oder Abschiebung: Die Vorteile eines globalisierten Kapitalismus wollten sie genießen, während die negativen Auswirkungen andere auf ihren Schultern tragen sollten. Gegen das »Gespenst des starken Mannes (oder der starken Frau)«3 und ihrer Gefolgschaften insistiert Baumann auf das aufklärerische europäische Erbe und ruft Immanuel Kants Artikel des »Weltbürgerrechts« in Erinnerung. Niemand habe mehr Recht als der andere, an einem Ort der Erde zu sein. Es sei kein Gast‑, sondern ein Besuchsrecht, ein Akt der Hospitalität.
»Unbewohnbare Teile dieser Oberfläche, das Meer und die Sandwüsten, trennen diese Gemeinschaft, doch so, daß das Schiff, oder das Kamel (das Schiff der Wüste) es möglich machen, über diese herrenlosen Gegenden sich einander zu nähern, und das Recht der Oberfläche, welches der Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu einem möglichen Verkehr zu benutzen.«4
Während sich die »wachsende Zahl moralisch blinder und tumber Internauten«5 mit ihren winzigen Digitalschiffen in Form von Smartphone und Tablet in den digitalen Untergrund »viraler« Gesellschaften zurückzieht, staut sich an der äußeren Realität der Oberfläche der Hass aufs Fremde auf. Ausgeschlossen ist dabei jedoch nicht, dass auch die »Fremden« den Hass aus ihrer »Heimat« importieren.
Vor dem Untergang
Die Ankunft der »Fremden«, die über das Mittelmeer ins Innere Europas kamen, empfanden die ohnehin dem politischen Projekt Europas der Vergangenheit entfremdeten Angehörigen der »Mittelschichten« und des Prekariats als Bedrohung der eigenen Existenz. Ähnlich wie im 19. Jahrhundert, als sich die »Alteingesessenen« in den USA gegen die Zuwanderung von Immigranten aus Irland und Deutschland mit Verschwörungstheorien auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagierten und sich im nativistischen Bund der »Know Nothings« organisierten, formierten sich im Zuge der »Flüchtlingskrise« in Europa reaktionäre Organisationen, die sich aus einer »neurotischen Verfolgungsangst« (wie Franz Neumann das Phänomen 1954 in einem Vortrag an der Freien Universität Berlin nannte) an autoritäre Traditionen der Vergangenheit hefteten. »Diese cäsaristische Identifikation ist stets regressiv – sowohl historisch als auch psychologisch«6, konstatierte Neumann.

Wie schon in F. W. Murnaus klassischem Abstiegsdrama Der letzte Mann (1924), in dem der uniformierte Hotelportier mitleidlos zum Toilettenwärter degradiert wird, vollzieht sich der Verlust des sozialen Status ohne Begreifen, welche gesellschaftlichen oder ökonomischen Prozesse für diesen Abstieg verantwortlich sind. Stattdessen führt die »politische Entfremdung« entweder zur entwerteten Selbstaufgabe und vollkommenen Lethargie oder zur »Auflösung« in regressiven »Massenbewegungen«, deren Ziel in der apokalyptischen Extermination des »Fremden« und des »Anderen« liegt. In neofaschistischen Sammlungsbewegungen wie Pegida in Dresden und deren zahlreichen Ablegern in anderen deutschen Städten artikulieren sich Rackets aus den Residuen barbarischer Volksstämme, die ihren Ressentiments gegen die Moderne mit ihren Konzeptionen der Urbanität, der Freiheit und der Autonomie freien Lauf lassen.
Je weniger die Pegida-Marschierer von den zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes begreifen, umso lautstarker beschwören sie auf ihren Kundgebungen dessen Untergang. Diffus rekurrieren sie auf den pränazistischen Bestseller Der Untergang des Abendlandes (1922), in dem Oswald Spengler, aus den dunklen Territorien des Ostharzes rund um Blankenburg kommend, über die Bedrohung des »kulturfähigen Menschentums« schwadronierte und vor dem Herabsinken zum »Typus des Fellachen« warnte. »Nur das primitive Blut bleibt zuletzt übrig«, schwante ihm, »aber seiner starken und zukunftreichen Elemente beraubt.«7 Eine Analyse realer Verhältnisse findet bei Spengler nicht statt: Stattdessen ergeht er sich im dunklen Raunen über den zivilisatorischen Verfall. »In der gigantischen und destruktiven Wahrsagerei triumphiert der Kleinbürger«8, urteilte Adorno über die »Geschichtsphilosophie« Spenglers.
 »Das Deutschland von 1930 bis 1933 war das Land der Entfremdung und Angst.«
»Das Deutschland von 1930 bis 1933 war das Land der Entfremdung und Angst.«
– Franz Neumann9
Das Gegenmittel gegen die »fake philosophy« ist jedoch nicht ein naiver Rekurs auf die europäische Kultur oder ein »Aufstand der Anständigen« (in dem sich die hypokritischen Nutznießer der schlechten Verhältnisse selbst Absolution erteilen), sondern die kritische Reflexion der Kultur, in die sich auch die Barbarei eingegraben hat.
 »Gegen den Untergang des Abendlandes steht nicht die auferstandene Kultur sondern die Utopie, die im Bilde der untergehenden wortlos fragend geschlossen liegt.«
»Gegen den Untergang des Abendlandes steht nicht die auferstandene Kultur sondern die Utopie, die im Bilde der untergehenden wortlos fragend geschlossen liegt.«
– Theodor W. Adorno10
Die Abstiegsgesellschaft

In seinem Buch Die Abstiegsgesellschaft analysiert der Soziologe Oliver Nachtwey die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen der sozialen Modernisierung in den letzten vierzig Jahren. »Die Moderne wird häufig gleichgesetzt mit Demokratie«, ruft Nachtwey gängige Wahrnehmungsmuster vor allem von Angehörigen einer aufstiegsorientierten Mittelschicht in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft in Erinnerung, »sie steht für Vernunft und Aufklärung, für die Institutionalisierung von Freiheit, Autonomie und Menschenrechten.«11 Realiter habe sich in der alten Bundesrepublik jedoch nicht die Klassengesellschaft aufgelöst; vielmehr wirkten deren Strukturen unterirdisch fort. Der Modernisierung sei das Moment der Regression eingegraben, insistiert Nachtwey in der Tradition der Kritischen Theorie.
 »Der Fluch des unaufhaltsamen Fortschritts ist die unaufhaltsame Regression.«
»Der Fluch des unaufhaltsamen Fortschritts ist die unaufhaltsame Regression.«
– Max Horkheimer und Theodor W. Adorno12
Im Zuge der »Modernisierung« des Sozialstaats seit den 1970er Jahren wurde immer mehr Lasten der sozialen Absicherung der Bürger und Bürgerinnen von staatlichen Wohlfahrtsinstitutionen auf die Schultern der Individuen gelegt. So liegt es in der »Eigenverantwortung« des Einzelnen, das Kapital für seine Altersvorsorge zu horten. In der neoliberalen Einrichtung der Gesellschaft wird jeder Bürger in die Komplizenschaft mit dem herrschenden System der kapitalistischen Ordnung gezwungen, die Nachtwey als der Erbe der »Künstlerkritik« der Revolte von 1968 sieht. Deren von einem antietatistischen Impetus bestimmten Akzentuierung von Autonomie, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung habe letztlich zu einem Rückzug staatlicher Organe aus der sozialen Verantwortung beigetragen. Diese »Künstlerkritik« (wie Nachtwey die »libertäre« Staatskritik aus dem »Geist von 1968« nennt) leistete der »Modernisierung« des Sozialstaats Vorschub, in deren Verlauf die »sozialen Bürgerrechte« reduziert wurden, während sich ein »autoritär grundierter Liberalismus« durchsetzte.13

5iese Entwicklung versucht Nachtwey im Bild der »Rolltreppe nach unten« zu fassen. Im stets wachsenden Konformitätsdruck sehen sich viele Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer gezwungen, über stromlinienförmige Anpassung an die »Agilität« scheinbar effizienter Produktionsprozesse, Mehr- und Leiharbeit, Mobilität und ständige Verfügbarkeit den eigenen Abstieg zu verhindern, obgleich sie in den Strom einer »imm4bilen Abwärtsmobilität« bereits gefangen sind.
 »In der Abstiegsgesellschaft sehen sich viele Menschen dauerhaft auf einer nach unten fahrenden Rolltreppe. Sie müssen nach oben laufen, um ihre Position überhaupt halten zu können.«14
»In der Abstiegsgesellschaft sehen sich viele Menschen dauerhaft auf einer nach unten fahrenden Rolltreppe. Sie müssen nach oben laufen, um ihre Position überhaupt halten zu können.«14
Im Prozess des eigenen Abstiegs richtet sich die Wut der Abgestiegenen nicht gegen die Verantwortlichen des Systems, sondern gegen jene, die ins Land strömen und den Alteingesessenen Wohnung, Arbeit und Brot streitig machen. Die Gewalt der Abgestiegenen richtet sich gegen noch Schwächere und findet seine Kanalisation in autoritären Strömungen, die letztlich auch bei jenen Resonanz finden, die sich als »links« verstehen, ohne dies inhaltlich füllen zu können. Als Ziel für den Ausweg aus der Sackgasse empfiehlt Nachtwey eine »solidarische Moderne«, wobei dieser Terminus eine leere Floskel bleibt. Ohnehin wabern durch Nachtweys vom »SocSpeak«15 durchtränkten Text Begriffe wie »melancholische Retronormativität« oder »Krise der linken Imagination«, die letztlich nur Partikel eines bedeutungsschwangeren Jargons sind, ohne dass sie hilfreich für eine kritische Bestandsaufnahme der aktuellen Zustände wären.16
Nachtweys Begriff der »Abstiegsgesellschaft« reduziert sich auf eine »deutsch-nationale« Perspektive, als hätte in den vergangenen fünfzig Jahren keine Migration stattgefunden. In der Erzählung des Autors sind die »Arbeitnehmer« vornehmlich deutscher Provenienz stets schon Opfer – der jeweils herrschenden Verhältnisse, der »Eliten«, der »Revolteure« von einst, des Neoliberalismus. In die »Komplizität« mit den vorwaltenden Herrschaftsstrukturen scheinen sie schuldlos hereingezogen worden zu sein, und ebenso schuldlos laufen sie den »Rattenfängern« der autoritären Strömungen in die Falle. Inwiefern diese Akteure, die immer nur andere als Sündenböcke für ihre missliche Lage verantwortlich machen, als Protagonisten für die Etablierung einer »solidarischen Moderne« intellektuell und politisch fähig sein sollen, bleibt ein Rätsel. Realiter sind sie nicht Opfer, sondern Mittäter. Schon bei der neoliberalen Einrichtung der Gesellschaft wäre es möglich gewesen, wie Herman Melvilles Bartleby mit – wie Lewis Mumford es nannte – »passivem Widerstand« zu reagieren: »I would prefer not to«.17 Stattdessen versuchten sie, mit der »Interessenanpassung« in der falschen Einrichtung der Gesellschaft den größtmöglichen Anteil der Beute für sich einzustreichen. Erst als diese Strategie sich als desaströs erwies, begann der große Katzenjammer. Dass ein großer Teil des sozialdemokratischen Milieus (beispielsweise im Ruhrgebiet) bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu Organisationen autoritärer, antidemokratischer Strömungen überlief, geht nicht auf das Konto der herrschenden Polit-Zirkel, sondern ist der fehlenden Verankerung demokratischer Prinzipien in der Bundesrepublik nach 1945 anzulasten.18
Die autoritäre Revolte

Die »Nachhaltigkeit« autoritärer Muster aus dem Fundus der deutschen Geschichte beschreibt der Historiker Volker Weiß eindrücklich in seiner prägnanten und aufschlussreichen Studie Die autoritäre Revolte. Darin rekonstruiert er kenntnis- und detailreich die Geschichte der »Neuen Rechten« im Schatten der »Konservativen Revolution« des Ideologen Armin Mohler und des »nationalen Flügels« der »68er«, der von Repräsentanten wie Günter Maschke und Frank Böckelmann, die über ihre rechten Zirkel und Zeitschriften wie Junge Freiheit, Sezession und Tumult hinaus ihre rechten Strahlen in das liberal-bürgerliche Spektrum senden, das immer schon für solche Signale empfänglich war.19 Akribisch arbeitet Weiß die »Arbeitsformen« rechter Intellektueller wie Mohler heraus, die zwar sich nicht scheuten, an den Verbrechen der Nationalsozialisten an allen Fronten im Zweiten Weltkrieg teilzunehmen, nach 1945 jedoch sich stets nur als »Opfer« fehlerhafter Entwicklungen stilisierten. Abseits des rechten Raunens und Murmelns bedienten sich Mohler und seine Vaganten an Antonio Gramscis Theorien der »ideologischen Hegemonie«, die in den 1970er Jahren zum »Basispaket« der linken Kultur- und Medientheorie gehörten.20
In einer »feindlichen Übernahme«, die an das »Détournement« der Situationisten erinnerte21, entlehnten rechtsextreme Intellektuelle wie Mohler (der als »konservativer« Einflüsterer Franz-Josef Strauß als deutschen de Gaulle an das politische Wahlvolk verkaufen wollte) und seine neofaschistischen Nachfolger wie Götz Kubitschek oder Björn Höcke linke Schlagworte, ohne ihre inhaltliche Grundierung zu übernehmen. Zu den Verdiensten von Weiß’ Buch gehört unter anderem, dass er die Spuren aus dem »linken« ins rechte Milieu verfolgt, etwa von der »linksradikalen« Gruppe »Subersive Aktion«, die 1962 in München von Dieter Kunzelmann in Anlehnung an die »Situationistische Internationale« gegründet wurde und zu der unter anderem Bernd Rabehl und Frank Böckelmann gehörten, die Jahrzehnte später zu den rechtsnationalen Stichwortgebern im intellektuellen Gewand mutierten. In rechtsextremen Formationen wie der »Konservativ-Subversiven Aktion« des rechtsintellektuell drapierten neofaschistischen Aktivisten Götz Kubitschek, der scheinbar linke Agitations- und Propagandaformen im Sinne einer antiwestlichen und antikapitalistischen Ideologie adaptiert und für einen neurechten Kampf gegen das bestehende demokratische System nutzt.
Darüber hinaus rekurrieren Kubitschek und andere »Rechtsintellektuelle« auf die diffusen Ressentiments der »altdeutschen« Mehrheitsbevölkerung, die sich von »Fremden« umlagert und bedroht fühlen, wobei das »Fremde« einerseits auf den »amerikanischen Kulturimperialismus« und andererseits auf die »Migranten« aus den südlichen Regionen projiziert wird. Zum einen verwehren den »wahren Deutschen« die Profiteure der amerikanisch dominierten Kulturindustrie das Ausleben ihrer deutschen Identität; zum anderen fühlen sie sich von »Aliens« muslimischer Herkunft heimgesucht, die ihnen das Leben permanent schwer machen. Die Lösung für die von sozialem Abstieg und dem Verlust einer nationalen Identität besteht nicht – wie von den »populistischen« Speerspitzen der »Wutbürger« behauptet – in der Resurrektion einer »direkten Demokratie«, sondern in einer autoritären Herrschaftsform, in der es klare Unterscheidungen zwischen Führer, Masse und Intellektuellen gibt, wie sie der von der deutschen Sozialdemokratie zum italienischen Faschismus gewechselte Soziologe Robert Michels beschrieb. Während im demokratischen System jede Unzulänglichkeit des einzelnen Funktionärs auf die Rechnung gestellt wird, übertrage im »charismatischen Führertum« die Masse »in bewußter Bewunderung und Verehrung und fast in Form eines selbstverständlichen, freiwilligen Opfers ihren Willen auf den Führer«22, der sich dank dieser irrationalen Akklamation der »Masse« von jeglicher Verantwortlichkeit enthoben fühlen kann.
In seiner fundierten und aufschlussreichen Studie rekonstruiert Weiß nicht allein die Geschichte der »neuen Rechten« in der Bundesrepublik nach 1945, sondern übt auch Kritik an den Schwächen der linken Auseinandersetzung mit den autoritären Strukturen der »deutschen Traditionalisten« auf der einen und der Migranten auf der anderen Seite, die ebenfalls ein nicht zu vernachlässigendes Gewicht an Vorurteilen – beispielsweise gegenüber Juden, Frauen und Homosexuellen – in ihrem Gepäck mit sich tragen. Eindringlich insistiert Weiß auf einer »tatsächlichen Aufklärung«, die sich selbst einer permanenten Kritik unterziehe, denn es sei »kein Naturgesetz, dass die Seite der Emanzipation gewinnt«.23
Rechtspopulismus oder Neofaschismus?
In der öffentlichen Diskussion werden die Tendenzen des Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus, wie sie sich seit den 1980er Jahren immer wieder in unterschiedlichen Formationen in Europa artikulierten, mit dem Begriff »Populismus« subsumiert, der zum einen kaum inhaltlich grundiert ist, zum anderen die politische Realität verschleiert. Mit Recht insistiert John Foster Bellamy, der Herausgeber der traditionsreichen linken Zeitschrift Monthly Review, dass der Terminus »Rechtspopulismus« einen Euphemismus darstellt, der sich auf Bewegungen der »faschistischen Gattung« beziehe, die mit ihren xenophobischen und ultranationalistischen Programmen Anklang vor allem bei Bürgern aus dem Milieu der unteren Mittelschicht (die früher unter der Bezeichnung »Kleinbürger« firmierten) und einer relativ privilegierten Arbeiterschicht finden.24

In seinem Essay Was ist Populismus? versucht sich der an der Princeton University lehrende Politologe Jan-Werner Müller an einer differenzierten Begriffsbestimmung, wobei er die unterschiedlichen Wertigkeiten zwischen Europa und den USA betont. Während in Nordamerika der populistische Impetus historisch einer linken Elitenkritik von den Sozialisten bis zur Neuen Linken in den 1960er Jahren verpflichtet war25, ist der Begriff in Europa zumeist reaktionär und antidemokratisch konnotiert. Auch wenn Müller das kritische Potenzial des Populismus, wie es in früheren Zeiten in den USA jenseits des Faschismus sich artikulierte, nicht in Abrede stellt, herrscht doch auch in seinem Essay die gängige Projektion des Populismus als antidemokratische Sprengkraft vor, wie sie im liberalen und neokonservativen Diskurs des Kalten Krieges von Historikern und Politologen wie Richard Hofstadter, Daniel Bell und anderen nachhaltig vertreten wurde. Populismus sei nicht allein antielitär, argumentiert Müller, sondern auch antipluralistisch, indem er gegen die »Elitenherrschaft« einen »Alleinvertretungsanspruch« des »wahren Volkes« in Stellung bringe, das sich im »Modus des permanenten Belagerungszustandes« befinde.26
 »Der autoritäre Staat ist die kapitalistisch verzerrte Karikatur des Sozialismus.«
»Der autoritäre Staat ist die kapitalistisch verzerrte Karikatur des Sozialismus.«
– Hans-Jürgen Krahl27
In seinem Essay stellt Müller durchaus interessante Fragen: Wie sollte der Umgang mit Populisten in einer Demokratie sein? Die Antwort kann nicht ein »autoritärer Staat« mit der Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sein. Zum anderen ist Müllers Populismus-Begriff selbst sehr eingeschränkt und vereinfachend, da er politische Beteiligung jenseits des liberal-konservativen Repräsentationsmodells als illegitim und undemokratisch betrachtet. »Populismus ist eine spezifische, der modernen repräsentativen Demokratie inhärente Gefahr«, stellt er kategorisch fest.28 Mit dieser Prämisse wäre auch eine Abkehr von der Atomindustrie nicht möglich gewesen. Außerhalb der Institutionen der »repräsentativen Demokratie« will Müller keine »legitimen« Äußerungen zulassen, wobei im abgezirkelten akademischen Terrain der Princeton University keine politischen sozialen oder ökologischen Probleme ins Gehege kommen.29 Zu Recht kritisiert Daniel Steinmetz-Jenkins in der Zeitschrift Dissent, dass Müllers Populismusverständnis auf einer Theorie des Antitotalitarismus fußt, die für einen nicht mehr existenten Feind entworfen wurde. Warum sollten sich abgehobene Eliten um abgehängte Kleinbürger und Arbeiter scheren? Und warum sollten sich die »Abgehängten« und »Ausgeschlossenen« einem System per »demokratischer« Akklamation unterordnen, das von der »Partei von Davos« beherrscht wird, wie Steinmetz-Jenkins die neoliberale Herrschaft des Finanzkapitals umschreibt? In »Zeiten wie diesen« sei Müllers Bestandsaufnahme zu optimistisch: »Die Demokratie zerfällt, und die populistischen ›Männer fürs Grobe‹ sind auf dem Vormarsch: Die Geschichte ist zurück.«30 Und die Geschichte führt nicht automatisch in eine bessere Zukunft.
Europa macht die Schotten dicht

Diesen Vormarsch skizziert Claus Leggewie in seinem Buch Anti-Europäer in den Porträts dreier für ihn exemplarischen Figuren, die einen »totalitären« Kampf gegen das »demokratische« Europa führen. Protagonist der »Identitären« ist der norwegische Massenmörder Anders Breivik, der 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen aus Hass auf den Islam und »Kulturmarxismus« tötete. Der »Eurasier« Alexander Dugin rekurriert auf das alte slawische »Antiwestlertum« und bewegt sich im Umkreis der autoritären »Putinisten«, während Abu Musab al-Suri als philosophisch verbrämter Stichwortgeber der »Dschihadisten« agiert. Leggewie möchte eine »Kritik der exterministischen Unvernunft«31 und »ein Stück Gegnerforschung« liefern, Spuren der Traditionen der »Konservativen Revolution« und des »völkisch-autoritären Nationalismus« in neuen Formationen der »Identitären«, »Rechtspopulisten« und »Islamisten« offenlegen, doch verheddert er sich oft in Abschweifungen, die sich von Ernst Jünger und Adolf Hitler bis zu den Repräsentanten des Autoritarismus wie Jaroslaw Kaczynski und Recep Tayyip Erdogan erstrecken, während er gegenüber Europa eine vollkommene unkritische Haltung einnimmt. Ständig hebt er die Liberalität, Weltoffenheit und Toleranz Europas hervor, ohne jemals den europäischen Imperialismus der Vergangenheit in Rechnung zu stellen.32
Zudem argumentiert Leggewie kaum politisch, sondern geißelt eine politische Figur wie Donald Trump aus der Position eines bürgerlichen Hochschulprofessors naserümpfend als »verkrachte Existenz«33, ohne die gesellschaftspolitischen Faktoren zu analysieren, die Trumps Aufstieg seit den 1980er Jahren begünstigten. Wie Müller hat auch Leggewie den ideologischen Raum des Antitotalitarismus des »Kalten Krieges« nicht verlassen. Über Kapitalismus und Faschismus finden sich in Leggewies »Gegnerforschung« keine Ansätze. Stattdessen wabert durch das Buch eine unkritische »Europa-Idolatrie«34 (wie Lothar Baier dieses Phänomen bereits in den 1980er Jahren bezeichnete), in der zum wiederholten Mal das »falsche Bewusstsein« seine akademischen Urstände feiert. Die Erzählungen über Angst, Niedergang und Unterwerfung müsse Europa »Narrative der Hoffnung und der Zivilcourage entgegensetzen«, schließt Leggewie wie ein altbackener Professor aus der Zeit, als man den Muff unter den Talaren mehr als deutlich wahrnahm. Zwar mahnt Leggewie »Zivilcourage« an35, vermag jedoch nicht die geringste Kritik im Sinne der Humanität vorzubringen, da »Europa die Schotten dicht macht«36 (wie Lothar Baier die europäische Abschottung gegen Migranten beschrieb). So setzt sich die Verlogenheit der »liberalen, weltoffenen und toleranten Europäer«, als deren Sprachrohr Leggewie fungiert, weiter fort.
Über dem »Reich des Konformismus« weht nicht lustig der »bunte Wimpel des Zweifels«37, wie Lothar Baier in den späten 1980er Jahren schrieb, als viele Menschen aus »Mitteleuropa« den vagen Versprechen einer universalen Demokratie zu folgen schienen. Mittlerweile möchte die Majorität der Mitteleuropäer die Freizügigkeit des NATO-Europas für sich reklamieren, während die Abschottung gegen den Süden militärisch vollzogen werden soll. Bevor die osteuropäischen Grenzen in den Jahren 1989/90 fielen, hatte der algerische Schriftsteller Rachid Boudjedra noch an seine europäischen Kollegen appelliert, dass dem »europäischen Traum« zunächst ein »europäisches Schamgefühl« vorangehen müsste.38 An solche kritischen Einsichten, die Spuren der Dialektik von Herrschaft und Opposition enthalten, möchte jedoch dreißig Jahre später niemand mehr erinnert werden. »Was wird die Europa-Idolatrie von Intellektuellen nützen, falls sich […] auftretende soziale Spannungen nationalistisch entladen?«, fragte Baier.39 Das Resultat ist gegenwärtig zu begutachten.
Bibliografische Angaben:
Zygmunt Bauman.
Die Angst vor den Anderen: Ein Essay über Migration und Panikmache.
Übersetzt von Michael Bischoff.
Berlin: Suhrkamp, 2016.
125 Seiten, 12 Euro.
Oliver Nachtwey.
Die Abstiegsgesellschaft: Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne.
Berlin: Suhrkamp, 2016.
264 Seiten, 18 Euro.
Volker Weiß.
Die autoritäre Revolte: Die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes.
Stuttgart: Klett-Cotta, 2017.
304 Seiten, 20 Euro.
Jan-Werner Müller.
Was ist Populismus? Ein Essay.
Berlin: Suhrkamp, 2016.
160 Seiten, 15 Euro.
Claus Leggewie.
Anti-Europäer: Breivik, Dugin, al-Suri & Co.
Berlin: Suhrkamp, 2016.
175 Seiten, 15 Euro.
© Jörg Auberg 2017
| Bildquellen (Copyrights) |
|
| Mischa Auer in Mr. Arkadin (Orson Welles, 1955) | Archiv des Autors |
| Cover Die Angst vor den anderen | © Suhrkamp |
| Cover Die Abstiegsgesellschaft |
© Suhrkamp |
| Cover Die autoritäre Revolte |
© Klett-Cotta |
| Cover Was ist Populismus? | © Suhrkamp |
| Cover Anti-Europäer |
© Suhrkamp |
| Szenenfoto Der letzte Mann | Kino.de |
| Bernadien Sternheim: Rolltrap | Wikimedia Commons |
Nachweise
- Theodor W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I, hg. Rolf Tiedemann (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003), S. 273 ↩
- Theodor W. Adorno, Soziologische Schriften I, hg. Rolf Tiedemann (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1979), S. 114–116 ↩
- Zygmunt Baumann, Die Angst vor den Anderen: Ein Essay über Migration und Panikmache, übers. Michael Bischoff (Berlin: Suhrkamp, 2016), S. 49 ↩
- Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (Berlin: Suhrkamp, 2011), S. 30 ↩
- Baumann, Die Angst vor den Anderen, S. 106–107 ↩
- Franz Neumann, The Democratic and the Authoritarian State: Essays in Political and Legal Theory (Glencoe: The Free Press, 1957), S. 293 ↩
- Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (München: Deutscher Taschenbuchbuch Verlag, 1972), S. 681 ↩
- Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I, S. 64 ↩
- Neumann, The Democratic and the Authoritarian State, S. 287 ↩
- Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I, S. 71 ↩
- Oliver Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft: Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne (Berlin: Suhrkamp, 2016), S. 71 ↩
- Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, »Dialektik der Aufklärung«, in: Horkheimer, Gesammelte Schriften, Band 5, hg. Gunzelin Schmid Noerr (Frankfurt/Main: Fischer, 1987), S. 59 ↩
- Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft, S. 82–108. Die »libertäre« Interpretation des »Geistes von 1968« findet sich beispielsweise in Thomas Schmid, »Die Wirklichkeit eines Traums: Versuch über die Grenzen des autopoietischen Vermögens meiner Generation«, in: Die Früchte der Revolte: Über die Veränderung der politischen Kultur durch die Studentenbewegung (Berlin: Wagenbach, 1988), S. 7–33. Zur Kritik cf. Jörg Auberg, »Die Illusion fährt mit der Straßenbahn: Intellektuelle Metamorphosen«, Die Aktion, Nr. 58–59 (November 1989), S. 907–909 ↩
- Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft, S. 165 ↩
- Der Begriff »SocSpeak« wurde erstmals vom Literaturkritiker Malcolm Cowley 1956 verwendet und beschreibt den Jargon der Gesellschaftstechniker, die offiziell als Soziologen bezeichnet werden. Cf. C. Wright Mills, The Sociological Imagination (1959; rpt. New York: Oxford University Press, 2000), S. 217 ↩
- Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft, S. 232–233 ↩
- Lewis Mumford, Herman Melville: A Study of His Life and Vision (1929; rpt. New York: Harcourt Brace, 1962), S. 163; Herman Melville, Billy Budd, Bartleby, and Other Stories, hg, Peter Coviello (New York: Penguin, 2016), S. 26 ↩
- Im Essener Norden holte die AfD 20 Prozent der Wahlerstimmen, https://www.derwesten.de/staedte/essen/afd-holt-ueber-20-prozent-der-stimmen-im-essener-norden-id210573525.html. Zur grundsätzlichen Problematik cf. Frank Bajohr und Dieter Pohl, Massenmord und schlechtes Gewissen: Die deutsche Bevölkerung, die NS-Führung und der Holocaust (Frankfurt/Main: Fischer, 2008); Stephan Hebel, »Merkel: Die Geburtshelferin der AfD«, Blätter für deutsche und internationale Politik, 62:8 (August 2017):81–88 ↩
- So wurde beispielsweise Frank Böckelmann in der Frankfurter Internet-Kulturzeitschrift Faust Kultur als der große »Entlarver« von Phantasmen von Privatheit und Macht hofiert: http://faustkultur.de/index.php?article_id=1893&clang=0 ↩
- Cf. Antonio Gramsci, »Die Herausbildung des Intellektuellen«, in: Gramsci, Marxismus und Kultur, hg. und übers. Sabine Kebir (Hamburg: VSA-Verlag, 1983), S. 56–72; Todd Gitlin, The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left (Berkeley: University of California Press, 1980), S. 9–10, 252–258. In der Vergangenheit ist Gramsci immer wieder von Rechtsextremen von Alain de Benoist bis zu Steve Bannon missbraucht worden: cf. Stefanie Prezioso, »Antonio Gramsci: From War to Revolution«, New Politics, XVI:3, Nr. 63 (Sommer 2017), http://newpol.org/content/antonio-gramsci-war-revolution ↩
- Cf. McKenzie Wark, The Beach Beneath the Street: The Everyday Life and Glorious Times of the Situationist International (London: Verso, 2011), S. 37–38 ↩
- Robert Michels, Masse, Führer, Intellektuelle: Politisch-soziologische Aufsätze, 1906–1933 (Frankfurt/Main: Campus, 1987), S. 183 ↩
- Volker Weiß, Die autoritäre Revolte: Die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes (Stuttgart: Klett-Cotta, 2017), S. 265 ↩
- John Bellamy Foster, »This is not Populism«, Monthly Review, 69:2 (Juni 2017), S. 1 ↩
- Cf. Michael Kazin, American Dreamers: How the Left Changed a Nation (New York: Alfred A. Knopf, 2011). In seiner Geschichte der US-amerikanischen Studentenbewegung SDS (New York: Random House, 1973) betonte Kirkpatrick Sale den Einfluss der populistischen Narodniks. ↩
- Jan-Werner Müller, Was ist Populismus? Ein Essay (Berlin: Suhrkamp, 2016), S. 69 ↩
- Hans-Jürgen Krahl, »Zur Geschichtsphilosophie des autoritären Staates« (1968), in: Krahl, Konstitution und Klassenkampf: Zur historischen Dialektik von bürgerlicher Emanzipation und proletarischer Revolution, hg. Detlev Claussen et al. (Frankfurt/Main: Verlag Neue Kritik, 1971), S. 224 ↩
- Müller, Was ist Populismus?, S. 28 ↩
- Cf. Timothy W. Luke, »Searching for Alternative Modernities: Populism and Ecology«, in: Luke, Capitalism, Democracy, and Ecology: Departing From Marx (Urbana: University of Illinois Press, 1999), S. 217–249 ↩
- Daniel Steinmetz-Jenkins, »The Logic of Populism«, Dissent, 64:2, Nr. 267 (Frühjahr 2017), Kindle-Ausgabe ↩
- Claus Leggewie, Anti-Europäer: Breivik, Dugin, al-Suri & Co. (Berlin: Suhrkamp, 2016), S. 141 ↩
- Cf. Wolfgang Reinhard, Die Unterwerfung der Welt: Globalgeschichte der europäischen Expansion 1415–2015 (München: C. H. Beck, 2016) ↩
- Leggewie, Anti-Europäer, S. 144 ↩
- Lothar Baier, Zeichen und Wunder: Kritiken und Essays (Berlin: Edition Tiamat, 1988), S. 187 ↩
- Leggewie, Anti-Europäer, S. 149 ↩
- Baier, Zeichen und Wunder, S. 179 ↩
- Baier, Zeichen und Wunder, S. 187 ↩
- Baier, Zeichen und Wunder, S. 186 ↩
- Baier, Zeichen und Wunder, S. 188 ↩