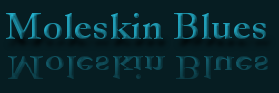Im Sumpf der kleinen Rackets
Philippe Kellermanns Sammelband zur Rolle des Anarchismus in der russischen Revolution bleibt im ideologischen Schlick stecken
Von Jörg Auberg

Zu Beginn der 1980er Jahre – in der Hochzeit der Hausbesetzerbewegung in der Bundesrepublik – veranstaltete die anarchistische Zeitschrift Schwarzer Faden einen Kongress zu den Ereignissen in Kronstadt 1921. In der anarchistischen Historiografie nimmt der Matrosenaufstand von Kronstadt den Status einer zweiten »Pariser Commune« ein und markiert den Endpunkt der Hoffnungen, die im »Oktober« geboren wurden, wie der russisch-amerikanische Anarchist Alexander Berkman als Zeit- und Augenzeuge jener Ereignisse in seinem Tagebuch The Bolshevik Myth (1925) schrieb. Sechzig Jahre später monierten Aktivisten und Aktivistinnen der Hausbesetzerbewegung, es gebe dringendere Probleme für Anarchisten, als noch einmal die Zelluloid-Leichen von Kronstadt vor einem neuen Blue Screen zu projizieren. Vielmehr bestehe die Aufgabe darin, die Zeitgemäßheit des Anarchismus unter Beweis zu stellen statt Nuancen in historischen Interpretationen zu diskutieren.
Eine ähnliche Kritik ließe sich gegen den von Philippe Kellermann herausgegebenen Band Anarchismus und russische Revolution hervorbringen. In Zeiten, da Autoritarismus und Neofaschismus, Antisemitismus und Xenophobie auf globaler Ebene zu triumphieren scheinen, gäbe es für eine radikale Gesellschaftskritik dringlichere Aufgaben, als die historischen Facetten des Anarchismus in der russischen Revolution zu beleuchten. Zwar erkennt auch Kellermann in seinem Vorwort die »sich mehr und mehr zusammenziehenden Wolken einer – sich politisch oder politisch-religiös [sic!] definierenden – faschistoiden Welle«1, doch scheint er mit der Analyse der aktuellen Geschehnisse nicht nur sprachlich, sondern auch konzeptionell überfordert zu sein.
Bramarbasierend verkündet die Verlagsreklame, dass im vorliegenden Band eine »neue Generation von Autoren zu Wort« komme, die »nicht nur einen neuen Blick auf die russische Revolution« eröffne, »sondern auch auf den historischen Kontext ihrer Rezeption außerhalb Russlands wie auf die internationale anarchistische Bewegung jener Zeit«. Jenseits der marktschreierischen PR (wie sie selbst für linke Verlage zum Alltagsgeschäft geworden zu sein scheint) bieten die Beiträge des Buches jedoch keineswegs neue historische Erkenntnisse. Vielmehr beschränkt sich der Band auf einen Querschnitt aus dem Fundus akademischer Forschungstechniker mit dem thematischen Schwerpunkt »Anarchismus und russische Revolution«, ohne realiter neue Fragestellungen aufzuwerfen.
Aus anarchistischer Perspektive werden die politischen Positionen von Anarchisten in der russischen Revolution, Oppositionsbewegungen wie die Partisanen in der Ukraine unter Führung des charismatischen Leaders Nestor Machno, die Rolle der »Maximalisten« und linken Sozialrevolutionäre sowie der Syndikalisten beschrieben. Darüber hinaus werden der hoffnungsvolle Blick aus dem Westen in die rote Sonne des Ostens und schließlich die Desillusionierung mit den Entwicklungen im Lande der Bolschewiki und das Verenden im prekären Exil jenseits der Grenzen des vorgeblichen »Mutterlandes des Sozialismus« betrachtet.

All dies wäre Material für nuancierte historische Erzählungen, doch gibt der Herausgeber schon in seinem Vorwort die »Losungen« für die ideologische Marschroute aus: Dass der Sozialismus auf lange Zeit kompromittiert sei, habe der Bolschewismus zu verantworten, denn dieser habe »dem Sozialismus einen solchen Schlag« versetzt, dass niemand mehr etwas von ihm wissen wolle. Dagegen präsentiert Kellermann »die Anarchisten« als »aktive, intervenierende Formationen«, die maßgeblich an den revolutionären Ereignissen beteiligt gewesen, jedoch um die verdienten Früchte ihrer aufopferungsvollen Arbeit betrogen worden seien.2 Schattierungen sind bei Kellermann nicht vorhanden; stets schon sind die Rollen von »Gut« und »Böse« im anarchistischen Scherenschnitt klar verteilt. In diesem eindimensionalen Szenario der Geschichte ist kein Raum für eine »Dialektik der Niederlage«, wie sie Russell Jacoby vor Jahrzehnten beschrieb. Aus den historischen Ereignissen rekurrierten die Verlierer auf das spiegelbildlich umgekehrte Ethos der Sieger: Ihre Niederlage speiste sich nicht aus falschen Realitätsvorstellungen oder unangemessenen politischen Strategien, sondern aus der Bösartigkeit ihrer diabolischen Gegner, die mit ihren irreführenden Verkleidungen die Agenten des Umsturzes nasführten und in den Abgrund des Totalitarismus leiteten.
Eine kritische Reflexion der anarchistischen Strategien und Aktivitäten in der russischen Revolution und den Jahren danach sucht man in diesem Band vergeblich. In ihrer Staatsfixiertheit trafen in dieser historischen Situation Leninisten und Anarchisten aus gegensätzlichen Richtungen aufeinander, ohne eine Konzeption einer revolutionären Umgestaltung auf demokratischer Basis zu besitzen. »Die bolschewistische Revolution von 1917–21 ist ein Lehrbuchbeispiel für die Aneignung einer breiten Volksbewegung durch eine hochzentralisierte Partei«3, diagnostizierte Murray Bookchin, der Theoretiker eines »libertären Kommunalismus«. Wie Mitchell Cohen in einer Kritik der leninistischen Praxis in der Zeitschrift Dissent betont, lehnten die Bolschewiki den »demokratischen Parlamentarismus« als Standbein des bürgerlichen Staates ab, erhielten aber die Instrumente der Staatsmacht – Bürokratie, Polizei und Armee – nicht nur aufrecht, sondern bauten sie als Werkzeuge einer autoritären Herrschaft aus.4 In erster Linie ging es den Bolschewiki darum, in einem politischen Machtvakuum unter dem Deckmantel des Marxismus die Staatsmacht zu erobern und als Racket sich zu etablieren. Davon unterschieden sich realiter auch die verschiedenen Formationen der Anarchisten, Syndikalisten und Maximalisten nicht, denen es nicht um die Etablierung einer »partizipatorischen Demokratie« (wie man es viele Jahrzehnte später nannte) ging, sondern um die Inbesitznahme lokaler Territorien, denen minoritäre Rackets ihren Stempel aufdrücken wollten.
»Die Geschichte des Anarchismus hat ihren Anteil an Sündern und Opportunisten […]«5, konstatierte Russell Jacoby 1987 in seinem Buch The Last Intellectuals. Im vorliegenden Band nimmt die »neue Generation« solche kritische Einwürfe nicht zur Kenntnis. Stattdessen bemüht sie sich in einem additiven Verfahren der Geschichtsschreibung Massen von Fakten aufzubieten, die sich in einem Wust von 1435 Fußnoten auf 416 Seiten austoben und stellenweise den Haupttext wie Karzinome überwuchern. Selbst marginale Quellen wie Postkarten und Telegramme, die aus den Riesenspeichern der Vergangenheit hervorgezerrt werden, dienen dazu, Gebirge von »Tatsachenschutt«6 (wie es Siegfried Kracauer nannte) aufzuschütten, um sich der Aufgabe einer konstruktiven Materialbewältigung zu entziehen. Das Resultat sind ermüdende Texte, die am Rande der Unlesbarkeit delirieren.
Trotz allem sind zwei Beiträge hervorzuheben, die aus der akademischen Maische heraus ragen. Vadim Damier erinnert an das kaum untersuchte Schicksal vieler Emigranten aus Russland, die in den 1920er Jahren in Berlin lebten (Charlottenburg hatte in jener Zeit den Spitzennamen »Charlottengrad«), ohne jedoch in die soziale und politische Tiefe dieser Geschichte einzutauchen. Ein staatenloser Emigrant wie Alexander Berkman, der – nur mit einem Nansen-Pass ausgestattet – durch Europa zog, auf eine prekäre Existenz zurückgeworfen und immer wieder von Ausweisung und staatlichen Repressalien betroffen war – repräsentierte den rechtlosen Flüchtling, der durch das vom Krieg gezeichnete Europa irrte.
Zum anderen beleuchtet Mitchell Abider die Zerrissenheit Victor Serges zwischen Anarchismus und Bolschewismus. Doch obwohl Abiders Text durch die adäquate Beschreibung der existenziellen Schattierungen einer historischen Figur besticht, ist er zugleich durch seine Bagatellisierung des Antisemitismus der aufständischen Matrosen in Kronstadt gezeichnet. Wie Paul Avrich in seiner Studie Kronstadt 1921 detailliert beschreibt, griffen bei den Aufständischen Antiintellektualismus und Antisemitismus ineinander: Während Lenin von jeglicher Kritik ausgenommen blieb, galten Trotzki, Kamenew und Sinowiew als Agenten einer jüdischen Weltverschwörung, welche in Russland die »erste jüdische Republik« etablieren wollten.7 mit Recht wies Ian Kershaw in seinem außerordentlichen Werk Höllensturz auf die destruktive Kraft des Antisemitismus in der Zerstörung Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hin. Indem der vorliegende Band, der vorgeblich »einen neuen Blick auf die russische Revolution« eröffnen will, Antisemitismus und Antiintellektualismus als zu vernachlässigende Petitessen darstellt, desavouiert er sich und sein Anliegen.
Addendum

Im Gegensatz zur anarchistischen Hagiografie, die Kellermann und seine Mitstreiter darbieten (Frauen kommen weder als Autorinnen noch als historische Subjekte in diesem Kompendium vor), liefert die Zeitschrift Socialist History Beiträge für eine kritische Geschichte des Anarchismus in der Oktoberrevolution und den Jahrzehnten danach. Während in Kellermanns Sammelband die üblichen anarchistischen Ressentiments gegenüber »dem Marxismus« in schalen Reprisen zur Schau stellt, argumentieren die Autoren und Autorinnen in dem von Kevin Morgan editierten Band differenziert und pointiert. In seinem Essay »Anarchism and Leninist Communism« weist Carl Levy darauf hin, dass vor 1914 eine historische Tradition eines libertären Sozialismus in Gestalt von Anarchismus und Syndikalismus bestand, die nach dem Fall der Sowjetunion revitalisiert wurde und sich in kapitalismuskritischen Bewegungen wie Occupy manifestierte. Bereits in den 1950er und und 1960er Jahren waren Einflüsse des Anarchismus in der politischen Kultur der US-Bürgerrechtsbewegung, des Situationismus in Europa und der globalen »68er«-Bewegung spürbar.
In ihrem Aufsatz »When Kropotkin Met Lenin« arbeitet Ruth Kinna die Unterschiede zwischen dem jakobinischen und dem libertären Revolutionsmodell heraus. Dabei geht es in erster Linie um die Frage, wie die einmal eroberte Macht gegen »Konterrevolutionäre« und kapitalistische Kräfte verteidigt und gesichert werden kann, ohne in autoritäre oder totalitäre Muster der Herrschaft zu fallen. Selbst unter Anarchisten gingen bei dieser Problematik auseinander: Errico Malatesta favorisierte einen kollektiven Klassenkampf gegen den Kapitalismus ohne eine Diktatur des Proletariats, während Peter Kropotkin für lokale Kooperationen als »nicht-autoritäre« Gegenmacht zur Zentralgewalt mit Bürokratie und Parteistrukturen eintrat, wobei sich Demokratie in der alltäglichen Praxis konstituieren und konstruieren sollte. Emma Goldmann schließlich schlug eine kulturelle Transformation des Bestehenden vor, die auch die traditionellen Geschlechterrollen einschloss.
Diesen Aspekt thematisiert Lisa A. Kirschenbaum in ihrem Beitrag »The Man Question: How Bolshevik Masculinity Shaped International Communism«, in dem sie den Zusammenhang zwischen praktizierter Autorität und zur Schau gestellter Männlichkeit analysiert. Da den Bolschewiki die Eroberung der Macht in Russland gelang, schienen sie vielen revolutionären Gruppen im Westen anderswo als Erfolgsmodell, dem es nachzueifern galt. Die leninistische Vorstellung, dass ein Funke einen Steppenbrand entzünden konnte, beflügelte nach 1917 nicht nur den ungarischen Revolutionär Bela Kun, der davon überzeugt war, dass der Aufstand die apathischen Massen »elektrifizieren« konnte, sondern auch »maoistische« Stadtguerillagruppen wie die »Weatherman« in den USA, die ihr politisches Manifest Prairie Fire betitelten.8 »Homage to success is homage to violence«9, konstatierte Russell Jacoby. Ein dunkles Beiprodukt der bolschewistischen Erfolgsgeschichte mit ihrer Betonung eines »Männerkultes« war die Militarisierung des gesellschaftlichen Kampfes, der vorgeblich auf Emanzipation und Gleichberechtigung ausgerichtet war, realiter jedoch auf Unterdrückung hinauslief. Der paramilitärisch organisierte Rotkämpferbund der KPD in der Weimarer Republik unterschied sich in seiner martialischen Zurschaustellung von Gewalt wenig von den SA-Truppen der Nationalsozialisten. Im kommunistischen Selbstverständnis wurden, stellt Kirschenbaum heraus, Frauen und Homosexuelle als schwächlich, unzuverlässig oder rückständig verachtet; allein mit revolutionärer Männlichkeit konnte »man« den strengen Anforderungen der Parteidisziplin genügen, die schließlich im Stalinismus mit vollkommener Unterwerfung der Individualität mündete.
Anders als Kellermanns ideologisch-akademischer abgedichteter Sammelband bietet das Oktober-Themenheft der Zeitschrift Socialist History nicht allein kritisch-historische Reflexionen über verschiedene Aspekte der russischen Revolution, sondern lässt auch die Bedeutung des »Oktober-Erbes« für die unterschiedlichen Ausprägungen der Linken in der Gegenwart nicht aus den Augen.
Bibliografische Angaben:
Philippe Kellermann (Hg.).
Anarchismus und russische Revolution.
Berlin: Karl Dietz Verlag, 2017.
416 Seiten, 29,90 Euro.
ISBN: 978–3‑320–02328‑7.
Kevin Morgan (Hg.).
Socialist History 52: Legacies of October.
London: Lawrence & Wishart, 2017.
128 Seiten, £ 10,00.
ISBN: 978–1‑912–06451‑9.
| Bildquellen (Copyrights) |
|
| Foto Alexander Berkman |
Marcia Stein. Digitalisierung: Project Gutenberg. [Public domain], via Wikimedia Commons |
| Cover Anarchismus und russische Revolution |
© Karl Dietz Verlag |
| Cover Socialist History 52 |
© Lawrence & Wishart |
Eine kürzere Fassung erschien in literaturkritik.de, Nr. 12 (Dezember 2017)
© Jörg Auberg 2017/2022
Nachweise
- Philipppe Kellermann, Vorwort zu Anarchismus und russische Revolution, hg. Philippe Kellermann (Berlin: Dietz, 2017), S. 9 ↩
- Kellermann, Vorwort, S. 9–10 ↩
- Murray Bookchin, From Urbanization to Cities: Toward a New Politics of Citizenship (London: Cassell, 1995), S. 222 ↩
- Mitchell Cohen, »What Lenin’s Critics Got Right«, Dissent, 64:4 (Herbst 2017), S. 20–31 ↩
- Russell Jacoby, The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe (New York: Basic Books, 1987), S. 100 ↩
- Siegfried Kracauer, Geschichte – Vor den letzten Dingen, übers. Karsten Witte (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1973), S. 108 ↩
- Paul Avrich, Kronstadt 1921 (1970; rpt. Princeton: Princeton University Press, 1991), S. 178–180 ↩
- Issac Deutscher, The Prophet: The Life of Leon Trotsky (London: Verso, 2015), S. 546; Dan Berger, Outlaws of America: The Weather Underground and the Politics of Solidarity (Oakland, CA: AK Press, 2006), S. 183–196 ↩
- Russell Jacoby, Dialectic of Defeat: Contours of Western Marxism (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), S. 5 ↩