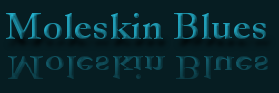Eine monströse Wunde
Kamel Daoud liefert mit seinem Debütroman Der Fall Mersault eine Gegendarstellung zu Albert Camus‘ Roman Der Fremde
Von Jörg Auberg
»Der Fremde von Camus fand schon unmittelbar nach seinem Erscheinen eine sehr günstige Aufnahme«1, begann Jean-Paul Sartre seine Rezension von Albert Camus’ Erstlingsroman L’Étranger im Jahre 1943. Mit Kamel Daouds Debütroman Der Fall Mersault, der eine Gegendarstellung zu Camus’ Werk darstellt, verhält es sich ähnlich. Für einen Romanerstling, der zunächst 2013 in Algier und ein Jahr später in Frankreich erschien, erhielt er eine ungewöhnliche Aufmerksamkeit von Seiten der Kritik. Nicht allein in den großen internationalen Tageszeitungen und Literaturzeitschriften wurde er von namhaften Kritikern wohlwollend bis begeistert rezensiert, sondern reüssierte auch sonst im internationalen Literaturbetrieb: Nur knapp verfehlte Daoud den renommierten französischen Literaturpreis Prix Goncourt.
Das internationale Interesse an einem Erstlingswerk eines arabischen Journalisten, der relativ spät den Weg zur Schriftstellerei fand, liegt in seiner Kritik einer europäischen Ikone begründet. Im negativen Sinne spiegelt sich dies in der nahezu hysterischen Erregung der beiden Kritiker Helmut Böttiger und Tilman Krause wider, die sich in einem Kritikergespräch des Deutschlandfunks am 14. März 2016 über Daouds »Naivität« und »Polemik« heftig erregten und in einer grotesken Arroganz einer deutsch geprägten europäischen Überheblichkeit dem arabischen Autor die intellektuelle Fähigkeit und Redlichkeit absprechen, den französischen Nobelpreisträger Camus kritisieren zu dürfen. In einer frappierenden Selbstgerechtigkeit unterstellen sie dem Autor Daoud eine intellektuelle Unfähigkeit, die französische Tradition der »impassibilité« von Stendhal und Gide zu begreifen oder den historischen Standpunkt des französischen Existenzialismus zu verstehen. Im anderen Extrem verglichen Kritiker etwas überhitzt Daoud mit Samuel Beckett und Jorge Luis Borges und erhoben den Roman in den Rang eines »unmittelbaren Klassikers« (wie beispielsweise Robin Yassin-Kassab im Guardian) oder rubrizierten ihn (wie Claire Messud in der New York Review of Books) als »ultimatives Camus-Mixtape«.2

In seiner erzählerischen Struktur rekurriert Der Fall Mersault – Eine Gegendarstellung auf Camus’ Spätwerk La Chute (1956; dt. Der Fall). In Form einer Lebensbeichte erzählt ein alter Mann namens Haroun einem Fremden in einer algerischen Bar von der Tötung seines Bruders am Strand durch Mersault und von den Ereignissen, die dieser Tat folgten. »Diese Geschichte müsste neu geschrieben werden«, postuliert der Erzähler, »in der gleichen Sprache, aber diesmal, wie das Arabische, von rechts nach links.«3 Nicht allein in der Verwendung der Sprache und in der Perspektive des Erzählten positioniert sich der Erzähler gegen das Original des »Mörder-Schriftstellers«4, sondern auch in der narrativen Strategie. Anders als »dieses nüchtern klare Werk«5 (wie Sartre Camus’ Roman L’Étranger klassifizierte) will sich der zuweilen in Weitschweifigkeit und Digressionen abdriftende Erzähler nicht der »Mathematifizierung« der Worte unterwerfen. Camus benutze die »Kunst des Dichtens, um den Schuss aus einer Waffe zu beschreiben«, ruft Haroun am Anfang aus. »Seine Welt ist sauber, wie erfüllt von der Klarheit des Morgens, präzise, eindeutig, durchdrungen von Aromen und durchzogen von neuen Horizonten.«6 In dieser kühlen Algebra der Worte wird jedoch die »monströse Wunde des Kolonialismus«7 (wie Daoud in einem Interview mit dem Camus-Experten Robert Zaretsky in der Los Angeles Review of Books sagte) verschwiegen.
»Der Fremde, das ist der Mensch, wie er der Welt gegenübersteht«8, schrieb Sartre in seiner Rezension, doch unterschlägt Camus in seinem Roman die Trennung von Franzosen und Araber, Kolonialherren und Kolonialisierten, indem er das arabische Opfer des Algerien-Franzosen Mersault in der Anonymität verharren lässt. In seinem Buch Culture and Imperialism aus dem Jahre 1993 hatte bereits Edward Said Camus vorgeworfen, durch die Namen- und Geschichtslosigkeit »des Arabers« bewege er sich in der »politischen Geografie Algeriens«, wie sie von der imperialistischen Macht Frankreichs im 19. Jahrhundert geschaffen wurde. Dem Text sei die imperiale Geste eingeschrieben, lautete der Vorwurf Saids.9 Ähnlich argumentiert auch Jeffrey C. Isaac in seinem Artikel »Camus on Trial« in der linken Zeitschrift Dissent: Während Camus in den 1930er Jahren als Journalist in Algerien für die Rechte der Araber eintrat, schien er sie in seiner Literatur nicht wahrzunehmen.10
Daouds Roman ist jedoch keine ressentimentgeladene Replik auf einen großen europäischen, in Algerien spielenden Roman, der sich der »amerikanischen Technik« von Romanautoren wie Ernest Hemingway bediente11 (wie Sartre in seiner Rezension schrieb), sondern eine Reflexion über das ungerechte Schicksal des Bruders, »in einem Buch zu sterben«12, als auch des Überlebenden, der unter den Rachegelüsten der Mutter zu leiden hat. Der Tod des Bruders lastet wie ein Alp auf den Gehirnen der »Zurückgebliebenen«. Rachedurstig drängt die scheinbar ewig lebende Mutter ihren überlebenden Sohn, den sie nur als Abbild ihres ermordeten Sohnes gelten lässt, in die willkürliche Tötung eines Kolonialfranzosen nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft im Juli 1962. Das Opfer bleibt in Daouds Gegendarstellung nicht namenlos, sondern wird als »Joseph Larquais« benannt. Analog zu Mersaults Teilnahmslosigkeit wird Haroun seine Passivität im »Befreiungskampf« vorgehalten: »Den Franzosen hättest du mit uns umbringen müssen«, wird ihm im Verhör vorgehalten, »im Krieg, nicht erst diese Woche!«13 So unterscheiden sich Mörder und Befreier.
Als Resultat der Befreiung vom kolonialen System der Europäer triumphierte in Algerien schließlich ein neues System der autoritären Herrschaft. Nicht die Emanzipation des Individuums wurde realisiert, sondern ein auf Nationalismus und Religion gegründete Diktatur. Für seine Kritik der Religion im algerischen Staat wurde Daoud von einem algerischen Salafisten mit einer Fatwa belegt. So endete die vorgebliche Emanzipation Algeriens in einer neuen brutalen Herrschaft. Einen neuen, besseren Menschen hat sie nicht geschaffen.
Bibliografische Nachweise:
Kamel Daoud.
Der Fall Mersault – Eine Gegendarstellung.
Aus dem Französischen von Claus Josten.
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2016.
208 Seiten, 17,99 EUR.
Eine kürzere Fassung erschien in literaturkritik.de, Nr. 6 (Juni 2016)
© Jörg Auberg 2016
Nachweise
- Jean-Paul Sartre, Der Mensch und die Dinge: Aufsätze zur Literatur, 1938–1946, übers. Lothar Baier et al., hg. Lothar Baier (Reinbek: Rowohlt, 1986), S. 75 ↩
- Robin Yassin-Kassab, »The Meursault Investigation by Kamel Daoud review – an instant classic«, Guardian, 24. Juni 2015, http://www.theguardian.com/books/2015/jun/24/meursault-investigation-kamel-daoud-review-instant-classic; Claire Messud, »The Brother of ›The Stranger‹, New York Review of Books, 22. Oktober 2015, http://www.nybooks.com/articles/2015/10/22/brother-stranger/ ↩
- Kamel Daoud, Der Fall Mersault – Eine Gegendarstellung, übers. Claus Josten (Köln: Kiepenheuer und Witsch, 2016), S. 17 ↩
- Daoud, Der Fall Mersault, S. 93 ↩
- Sartre, Der Mensch und die Dinge, S. 89 ↩
- Daoud, Der Fall Mersault, S. 11 ↩
- »Insolence, Exile, and the Kingdom: Robert Zaretsky interviews Kamel Daoud«, Los Angeles Review of Books, 9. Juni 2015, https://lareviewofbooks.org/article/insolence-exile-and-the-kingdom ↩
- Sartre, Der Mensch und die Dinge, S. 77 ↩
- Edward Said, Culture and Imperialism (London: Vintage, 1994), S. 204–224, insbes. S. 210 und 213 ↩
- Jeffrey C. Isaac, »Camus on Trial«, Dissent, Winter 2016, https://www.dissentmagazine.org/article/camus-on-trial-kamel-daoud-meursault-investigation-review ↩
- Sartre, Der Mensch und die Dinge, S. 86 ↩
- Daoud, Der Fall Mersault, S. 55 ↩
- Daoud, Der Fall Mersault, S. 156 ↩