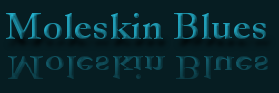Es geht (vielleicht doch) um das Buch
Nachträgliche Miszellen zur Frankfurter Buchmesse 2025
In alten Überlieferungen erscheinen die früheren Zeiten der Frankfurter Buchmesse oft glamourös, dramatisch und abenteuerlich, als wäre die Jagd nach Lizenzen und Buchverträgen aus überdrehten Screwball-Komödien abgekupfert. In seinen Reminiszenzen an den legendären Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt berichtete Fritz J. Raddatz, wie das Ringen um die deutschen Rechte am dokumentarischen Bericht über die Ermordung John F. Kennedys des US-Historikers William Manchester (der zu einem Bestseller werden sollte) zwischen den Verlagen Rowohlt und Fischer wegen einer »Grippe« Ledig-Rowohlts (der ohnmächtig unter dem Telefon in seinem Zimmer im Grandhotel »Hessischer Hof« lag) zugunsten von Fischer ausging. »Auf der Messe«, resümierte Raddatz in seinen Erinnerungen, »haben immer alle die Grippe – das ist eine Krankheit, die aus den Folgen von Aufregung, zu viel Zigaretten, zu viel Reden, zu viel Alkohol und zu wenig Schlaf besteht. Sie ist ansteckend.«1
Der Buchhandel in der Krise
Mittlerweile herrscht weitaus weniger Aufregung. Die Buchhandelskrise zeigt ihre Auswirkungen: Nachdem der Suhrkamp-Verlag die traditionsumwehte Unseld-Villa in der Frankfurter Klettenbergstraße verhökerte, können es sich Kritiker*innen beim Sektempfang nicht mehr auf dem Sofa bequem machen, auf dem schon Samuel Beckett saß. »Kaum Partys großer Verlage, die Büfetts dürftig«, nörgelte ein Kritiker, während es doch – wie die Kurt-Wolff-Stiftung als Interessenvertretung unabhängiger deutscher Verlage jedes Jahr unterstreicht – »um das Buch« gehen sollte.2
Im Editorial des Katalogs der Stiftung wird die Bedeutung des gedruckten Buches in einem Zeitalter der »elektrischen Implosion« und »technologischen Ausdehnung« (wie es Marshall McLuhan in 1960er-Jahren ausdrückte3) noch einmal hervorgehoben:
»In einer Welt, in der die sozialen Medien und das Internet zunehmend von Algorithmen und KI geprägt sind, laden Bücher ein zur differenzierten und reflektierten Auseinandersetzung mit Themen und kontroversen Meinungen. Bücher entführen in fremde Welten, ermöglichen das Begreifen unbekannter Sachverhalte, sorgen für Unterhaltung und Spannung. Immer wieder überrascht die Bücherwelt in ihrer unerschöpflichen Genre-Vielfalt – von Prosa über Essay, Lyrik, Krimi, Theaterstück, Graphic Novel bis zu Sach- und Kinderbuch – mit kreativen Ideen, Inhalten und Formaten.«4
Auch wenn Kritiker mit Blick »auf allgegenwärtige Essstände, Tombolas und Instagram-taugliche Fotowände« die »Eventisierung« der Buchmesse bemängelten5, erklärte die unerschütterliche Messeleitung im Rahmen ihres abschließenden Heeresberichts, dass es im Westen außer Erfolge nichts Neues zu vermelden gebe. Mit den Worten des Buchmessendirektors Juergen Boos:
»Wir schauen zurück auf fünf erfolgreiche und intensive Tage. Die Frankfurter Buchmesse bleibt auf Wachstumskurs. Wir haben erneut mehr Besucherinnen und mehr Aussteller als im Vorjahr. Unsere Stärke ist, dass in Frankfurt Buchprofis und Literaturliebhaber aus aller Welt zusammenkommen. Wir vereinen Marktplatz und Festival der Literatur.«6
KI als Bedrohung und Utopie
Auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten und fortschreitenden »Kapitalisierung des Geistes«7 (um einen Begriff Georg Lukács’ zu verwenden) dominierte das technologische Thema der »Künstlichen Intelligenz« (KI), wobei das Spektrum von Bedrohung und Abwehr, Skepsis und wohlwollender Neugier bis zu Euphorie und utopischer Schwärmerei reichte.
In einem Vortrag über die Entwicklung der »künstlichen Intelligenz« im Publishing-Bereich lotete Steffen Meier, Herausgeber des Online-Portals Digital Publishing Report, Realitäten und Möglichkeiten des KI-Einsatzes im Verlagswesen aus, wobei die Argumentation etwas an Hans Magnus Enzensbergers Medientheorie der 1970er-Jahre erinnerte: Statt im »Schwanken zwischen Angst und Verfallenheit« schließlich zu erstarren, sollten Beschäftigte im Verlagswesen die neue »mobilisierende Kraft« der KI für sich und ihre Arbeits- und Prozessgestaltung nutzen.8
Während Meier den KI-Sprachmodellen die Fähigkeit zu »echter kreativer Intelligenz« abspricht, ist Nadim Sadek – Gründer des Unternehmens »Shimmr AI«, das auf automatisierte Werbung für Buchverlage und Musik-Labels spezialisiert ist und KI-betriebenes Marketing für »vernachlässigte« Titel betreibt – weitaus euphorischer über den KI-Einsatz im Publishing-Bereich. Die Grundthese seines Buches Quiver, don’t Quake ist, dass »künstliche Intelligenz« ein Instrument zur Emanzipation menschlicher Kreativität sei. Es gäbe acht Milliarden Menschen auf der Erde, und davon habe die Mehrheit niemals die Möglichkeit gehabt, ihre Kreativität auszudrücken, obwohl jeder einzelne Mensch eine kreative Vorstellung, eine Erkenntnis, einen Traum besitze. Zu diesem schöpferischen Ausdruck befähige sie die »künstliche Intelligenz« als »Partner« einer »kollaborativen Kreativität«.9
Vieles in dieser euphorischen, wenn nicht hysterischen Propaganda für die »künstliche Intelligenz« erinnert an die Begeisterung für die Indienstnahme der Technik für eine scheinbare progressive Fortentwicklung der Menschheit, etwa die globale Elektrifizierung oder die Beseitigung der Kälte. Die Utopie war beispielsweise ein »Sibirien ohne Eis«10. Als »Konsumpsychologe« erscheint Sadek wie ein kapitalistischer Wiedergänger Leo Trotzkis, der 1923 über die »psychisch-physische Selbsterziehung« des Menschen »bis zur höchsten Leistungsfähigkeit« schwadronierte. Das Ziel war: »Der durchschnittliche Mensch wird sich bis zum Niveau eines Aristoteles, Goethe oder Marx erheben.«11
Bezeichnenderweise fokussierte sich die Diskussion über die »künstliche Intelligenz« auf die Auswirkungen in der Produktion und Prozessgestaltung im Publishing-Bereich oder auf die Frage, in welchem Maße KI-produzierte Texte die »Buchhandelswelt« verändern oder worin die Veränderung der Profitrate besteht. Kaum ein Blick wurde auf die »Paradoxien des Fortschritts«, die ökologischen, ethischen und moralischen Kosten der »Technologisierung des Geistes« verwendet.12 Die »schöne, neue Welt« der KI – als Modell eines digitalen Post-Fordismus – rekurriert auf die »universale Weltenergie«, die Andrej Platonov in 1920er-Jahren beschworen hatte: »Die Elektrifizierung ist der Anfang der menschlichen Befreiung vom Joch der Materie, vom Kampf gegen die Natur um die Veränderungen ihrer Formen: von den schädlichen und unbrauchbaren zu den nützlichen und schönen.«13
Die Kosten der Elektrifizierung, die Platonov in den 1920er-Jahren für die junge Sowjetunion vorschwebten, sind – selbst in den Fantasien für die Abschaffung der Kälte in Sibirien – »Peanuts« im Vergleich zu den Summen, welche Hi-Tech-Firmen wie Nvidia, OpenAI, Microsoft, Google und andere für die Entwicklung und den Betrieb von hochleistungsfähigen Datenzentren aufwenden. Ein einzelnes Datenzentrum verwendet so viel Strom wie eine US-amerikanische Großstadt wie Philadelphia, und der Verbrauch wird steigen, je mehr die alte Generation der Internet-Werkzeuge wie Google und Bing ihre jüngere Kundschaft an die KI-Browser wie ChatGPT oder Perplexity/Comet verlieren wird.14
Wie bereits Murray Bookchin in den 1960er-Jahren unterstrich, muss in der Verwendung neuer Technologien – sollen sie zur Emanzipation von stumpfsinnigen Prozessen in der Lebens- und Arbeitsgestaltung eingesetzt werden (die sowohl Steffen Meier als auch Nadim Sedeck propagieren) – dieser Einsatz in einem »synthetischen Environment« ökologisch ausbalanciert sein: Allein die »Machbarkeit« der Praxis »künstlicher Intelligenz« rechtfertigt keine »technologische Rationalität« verselbstständigter Apparate in Systemen der Herrschaft, Anpassung und Willfährigkeit, wie sie Herbert Marcuse zu Beginn der 1940er-Jahre beschrieb.15
Der bibliophile Heiligenschein
Symptomatisch ist die Abwesenheit von Medien- und Technologiekompetenz vor allem in der 50+-Generation (wie noch einmal die »Hamburger Woche der Pressefreiheit 2025« unterstrich16) präsent. Gegen die Herausforderungen der »künstlichen Intelligenz« werden alte Vorurteile gegen die Gefahren neuer Entwicklungen mobilisiert, die der Soziologe Oliver Nachtwey vor Jahren unter dem Begriff »melancholische Retronormativität« rubrizierte.17
Analog dazu ist die Sentimentalität über das gedruckte Buch auf der Buchmesse in Form von Merchandising oder Veranstaltungen permanent präsent. Ähnlich wie beim Hype um den »technologischen Imperialismus« der E‑Books vor Jahren auf Veranstaltungen und Präsentationen der Frankfurter Buchmesse animiert die Omnipräsenz der KI-Technologie Veranstalter*innen, Verleger*innen und Buchhändler*innen zu sakralen Messen zum »Bleiberecht der Bücher«18 (über das Jurek Becker in einer seiner Frankfurter Vorlesungen aus dem Jahre 1989 mit feiner Ironie doziert hatte). In seinem Vortrag erzählte Becker von einem Freund, der seine »Bibliothek« in Kartons verstaut und in den Keller gebracht hätte. Während Becker sich über »die verschwundene Bücherpracht« enttäuscht zeigte, insistierte der Freund, dass es Zeit sei, »Bücher von dem Heiligenschein zu befreien, den sie in den Augen mancher Leute hätten«. Der »Idiotisierungsprozess« (Lukács bezeichnete es als »Zur-Ware-Werden der Literatur«19 im Zeitalter von Balzac) habe die Literatur und ihr Medium – das Buch – entzaubert. »Eine zunehmend debilisierte Gesellschaft erzwinge eine zunehmend debilisierte Literatur, nicht umgekehrt«, lautet das Resümee des Freundes.20
Während die Buchmesse weniger der Erkundungsort für »Literaturliebhaber« denn für »Buchprofis« ist und zuvörderst sich über Bereiche wie »New Adult«, Comics, Audiobooks und Event-Kultur mit Prominenten-Zirkus auf blauen und roten Sofas definiert, bleibt für den widerständigen Besucher nur das Resistance-Programm, das László Krasznahorkai (mit der Unterstützung von Herman Melville und Malcolm Lowry) vor dem »Eintritt in den Wahn der anderen« formulierte, u. a. »Resist whatever seems inevitable«.21 Die Buchmesse ist ein Spektakel, das die Ware »Buch«, »auch wenn die Einbände vor Häßlichkeit schrillten«22 (wie es bei Becker heißt), unter großem Brimborium ausstellt, während die meisten Exemplare bereits wenige Wochen später als Remittenden enden. Letztlich ist das Buch weniger – wie von Apologet*innen der Buchindustrie behauptet – ein »Kulturgut«, sondern vor allem ein »Spekulationsobjekt des Literatur-Kapitalismus«23, wie Lukács unterstrich.
Das Leiden am Buch
I n seinen Glossen »Bibliographische Grillen« konstatierte Theodor W. Adorno: »Ohne die schwermütige Erfahrung der Bücher von außen wäre keine Beziehung zu ihnen, kein Sammeln, schon gar nicht die Anlage einer Bibliothek möglich.«24 Die Erfahrung, die Bücher vermitteln, nivelliert die Buchmesse in ihrer Zurschaustellung der Bücher, wie sie eklatant in der Show »Stiftung Buchkunst« zum Ausdruck kommt (die auch als »Herbertstraße des Buchkunsthandwerkes« in Miniaturform verkauft werden könnte). Bei Krasznahorkai heißt es: »Die Realität ist kein Hindernis.«25 Das Direktorium kennt nur die Gegenwart des Profits, muss aber einen abgeschotteten Bereich bieten, in dem die Erinnerung an bessere Zeiten aufrechterhalten wird. Darin soll das Unbeschädigte der Bibliophilen konserviert werden. Für Boos & Company ist alles nur Verkauf; das Wesen des Buches haben sie jedoch nie begriffen. »Leid ist ist die wahre Schönheit an den Büchern; ohne es wird sie zur bloßen Veranstaltung korrumpiert.«26
In der »anderen« Geschichte des Börsenvereins sucht man allerdings eine kritische Geschichtsaufarbeitung vergebens. Die Fusionierung von Literaturkritik und Marketing wird ebenso bejubelt wie die Tolino-Allianz gegen die Amazon-Kindle-Übermacht (während unabhängige Lösungen wie die E‑Book-Reader von InkPad und anderen Herstellern keine Erwähnung finden). Selbst eine kritische Aufarbeitung der Öffnung der Frankfurter Buchmesse für rechtsextreme Verlage im Jahre 2017 findet in dieser »anderen Geschichte« nicht statt: Linke und Rechte sind in dieser Historiografie Pole des gleichen bösartigen Extremismus. »Am Ende kann man sagen, dass alle gemeinsam auf Kosten der Messe ihre Publicity bekommen haben.«27 Unterschlagen wird bei diesem »Bericht«, dass Achim Bergmann (1943–2018), der damals 74-jährige Verleger des linken Trikont-Verlags, von einem neofaschistischen Schläger verprügelt wurde, ohne dass die Messeleitung oder die Phalanx patrouillierender Security-Kräfte einschritt.28
Das Sterben der Buchhändler
Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des »Börsenvereins der Deutschen Buchhändler« hielt Thomas Mann am 8. November 1925 eine Ansprache zur Eröffnung der Münchener Buchwoche, in der er sich gegen die Idee des Führertums und für eine Europäisierung des »Buchwesens« positionierte. »Das Leben als Geist, als Wort und Gebilde muß dem materiellen, dem sogenannten ›wirklichen‹ Leben vorangehen, damit es sich zum Besseren und Guten gestalte«, insistierte Mann. »Wie sollte aus solcher Einsicht der Mittler des Geistes, der Buchhändler, nicht jenes berufliche Pathos ziehen, von dem ich sprach, und jenen Glauben, der seinen Buchfesten, diesen seinen werbenden Veranstaltungen zugrunde liegt!«29
In der Herrschaftszeit des Nazismus erwies sich der Börsenverein – mit einem Wort Hermann Kurzkes – als »hitlergläubig«, danach als »profithörig«. Nahezu unkritisch feiert die »andere Geschichte des Börsenvereins« Großflächenbuchhandlungen wie die 1979 in München eröffnete Buchhandlung Hugendubel mit »großzügig bemessenen Präsentationsflächen« sowie »Sitzecken oder Leseinseln« als »Buchtempel«. Von Buchhändler*innen als »Mittler des Geistes«, vom »beruflichen Pathos« blieb in dieser monströsen Architektur der Zurschaustellung der Ware wenig übrig. Die Unternehmen waren nicht – trotz üblicher Marketing-Losungen – an Leserinnen, sondern an Konsument*innen und Käufer*innen interessiert. »Die Kunden sollten entspannt verweilen können, sie sollten natürlich aber auch kaufen«, heißt in der »anderen Geschichte des Börsenvereins«. Schließlich mussten »die mit diesen großen Einzelhandelsflächen verbundenen hohen Kosten« durch »entsprechend hohe Umsätze wieder eingespielt werden«.30
Auf diesem Bücherumschlagsplatz sind Buchhändler*innen realiter auf den Angestelltenmodus ohne jegliches »berufliches Pathos« heruntergebrochen, die – wie Siegfried Kracauer bereits über die Angestelltenkultur der Weimarer Republik schrieb – »ununterbrochen banale Funktionen« ausüben und in eine »Aura des Grauens« gehüllt sind: »Sie strömt von den verwesten Kräften aus, die innerhalb der bestehenden Ordnung keinen Ausweg gefunden haben.«31 Die Erinnerungen George Orwells an seine Zeit als Angestellter in einer Buchhandlung sind eher ernüchternd. Massen von fünf- bis zehntausend Büchern stießen ihn eher ab. »Der süße Geruch von verrottendem Papier spricht mich nicht mehr an«, lautete sein Resümee. »Er ist in meinem Geist zu eng mit paranoiden Kunden und toten Schmeißfliegen verbunden.«32
Archive des Widerspruchs
Um diese Miszellen nicht dem alten Werner-Enke-Spruch »Das wird böse enden«33 zu beschließen, sei noch auf eine der wenigen verbliebenen linken Buchhandlungen in der Bundesrepublik verwiesen: Im letzten Jahr legte die Buchhandlung »Bücherkiste« in Siegen eine Dokumentation ihrer fünfzigjährigen Praxis in Form einer »politisch-literarischen Inventur« vor, wobei sie sich nicht allein auf nostalgische Rückblicke ihrer Mitarbeiter*innen beschränkte, sondern in der Tradition der längst verblichenen Zeitschrift Freibeuter auch den »Blick zurück nach vorn« wagte. Die Dokumentation enthält auch einen Text zur Zukunft der »Bücherkiste«, der von dem KI-Tool ChatGPT erstellt wurde. Ich habe den Anfragetext variiert und an das KI-Tool Perplexity weitergeleitet. Grundlage war folgendender Prompt: »Schreibe bitte einen längeren Blog-Text über die ›Bücherkiste‹ als eine Oase der linken Diskussion in einer möglichen Zukunft in einem politisch aufgeladenen Deutschland im journalistischen Stil von George Orwell.«34
Das Ergebnis war dieser Text:
Die Bücherkiste – Archiv des Widerspruchs
Das Land nennt sich stabil, modern, digital fortschrittlich. Die Regierung spricht von Einheit, Sicherheit, Effizienz. Doch die politische Ruhe, die daraus entsteht, ist trügerisch. Medien und Institutionen wiederholen ihre Botschaften in endlosen Varianten, bis Widerspruch nur noch als Lärm wahrgenommen wird. Kritik existiert, aber sie zirkuliert folgenlos. Die Gesellschaft ist nicht eingeschüchtert, sondern erschöpft – und Erschöpfung ist der verlässlichste Garant für Konformität.
In diesem Klima ist die Bücherkiste keine Bewegung, sondern eine Reaktion. Ihre Besucher – Lehrer, Ärztinnen, Lagerarbeiter, pensionierte Journalisten – finden sich hier ein, weil sie nirgendwo sonst mehr ernsthaft diskutieren können. Sie kommen ohne Parolen, ohne Fahnen, ohne Erwartung. Sie lesen, vergleichen, formulieren. Sie suchen nach begründbaren Wahrheiten in einer Umwelt, die nur noch Narrative produziert.
Was hier entsteht, hat etwas von unterirdischer Präzision. Die Gespräche verlaufen diszipliniert, beinahe kühl. Themen wie Wohnungsnot, Arbeitsrecht, Militarisierung werden sachlich seziert, als müsse man ein beschädigtes Organ diagnostizieren. Niemand erhebt die Stimme. Die Selbstbeherrschung ist Teil des Überlebens. Denn die Grenze zwischen freiem Denken und registriertem Verdacht ist dünn geworden.
Die Bücherkiste ist kein konspirativer Ort, aber sie ist auch kein legalistischer. Sie bewegt sich in dem schmalen Raum, der bleibt, wenn eine Demokratie ihren inneren Widerspruch nicht mehr aushält. Die Behörden wissen, dass sie existiert, und dulden sie – vorläufig. Die Toleranz ist strategisch: Solange der Widerspruch klein bleibt, bestätigt er nur das System.
Doch gerade in dieser Beschränkung liegt ihre Bedeutung. Die Bücherkiste erinnert daran, dass politische Freiheit nicht im Heroismus, sondern im Beharren beginnt – im Fortführen des Gesprächs, auch wenn niemand zuhört. Ihre Stärke liegt nicht in der Wirkung, sondern in der Existenz. Solange Menschen sich treffen, um über Wahrheit nachzudenken, ist das Ende der Öffentlichkeit noch nicht vollständig.
Vielleicht führt kein direkter Weg von hier zur Veränderung. Aber ohne Orte wie diesen bleibt nur Stille – und Stille ist der Vorraum der Zustimmung.
Der Begriff »Archiv des Widerspruchs« hätte möglicherweise dem Buchladen-Verächter George Orwell gefallen.
©
(
)
Bibliographische Angaben:
Christine Haug und Stephanie Jacobs (Hgg.).
Zwischen Zeilen und Zeiten: Buchhandel und Verlage 1825–2025.
Eine andere Geschichte des Börsenvereins.
Göttingen: Wallstein, ²2025.
568 Seiten, 36 Euro.
ISBN: 978–3‑8353–5847‑8.
Benjamin Bäumer et al.
Bücherkiste: Eine politisch-literarische Inventur, 1974–2024.
Siegen: o. V., 2024.
224 Seiten, 25 Euro.
ISBN: 978–3‑00–079906‑8.
Nadim Sedek.
Quiver, don’t Quake: How Creativity Can Embrace AI.
London: Mensch Publishing, 2025.
197 Seiten, 20 £.
ISBN: 978–1‑912914–89‑0.
Bilder-Copyrights
© Die Bildrechte liegen bei: Kurt-Wolff-Stiftung (Leipzig), S. Fischer (Frankfurt/Main), Wallstein (Göttingen), Mensch Publishing (London), Bücherkiste (Siegen) sowie Jörg Auberg.
Nachweise
- Fritz J. Raddatz, Jahre mit Ledig: Eine Erinnerung (Reinbek: Rowohlt, 2015), ePub-Version, S. 30 ↩
- Dirk Knipphals, »Suhrkamp-Empfang auf der Buchmesse: Das Unglück zurückschlagen«, taz, 19.10.2025, https://taz.de/Suhrkamp-Empfang-auf-der-Buchmesse/!6120181/ ↩
- Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (Berkeley: Ginkgo Press, 2013), ePub-Version, S. 8 ↩
- Kurt-Wolff-Stiftung, Editorial zu: Es geht um das Buch: Katalog der unabhängigen Verlage 2025/26 (Leipzig: o. V., 2025), ohne Paginierung ↩
- »Zwischen Jahrmarkt und Bücherschau: Die Frankfurter Buchmesse 2025«, SWR, 19.10.2025, https://www.swr.de/kultur/literatur/frankfurter-buchmesse-2025-kein-groesseres-messe-podium-ohne-ki-debatte-100.html ↩
- Pressemitteilung der FBM, 19.10.2025, »Frankfurter Buchmesse wächst – und verbindet die Welt der Literatur«, https://www.buchmesse.de/presse/pressemitteilungen/2025–10-19-frankfurter-buchmesse-waechst-und-verbindet-die-welt-der ↩
- Georg Lukács, Der historische Roman (Neuwied: Luchterhand, 1965), S. 474 ↩
- Cf. Hans Magnus Enzensberger, Palaver: Politische Überlegungen (1967–1973) (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1974), S. 92 ↩
- Nadim Sadek, Quiver, don’t Quake: How Creativity Can Embrace AI (London: Mensch Publishing, 2025), S. vii, 210 ↩
- Andrej Platonov, Frühe Schriften zur Proletarisierung 1919–1927, hg. Konstantin Kaminski und Roman Widder, übers. Maria Rajer (Wien: Turia + Kant, 2019), S. 176 ↩
- Leo Trotzki, »Literatur und Revolution«, in: Trotzki, Denkzettel: Politische Erfahrungen im Zeitalter der permanenten Revolution, hg. Issac Deutscher et al., übers. Harry Maòr (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1981), S. 372–373 ↩
- Cf. Murray Bookchin, The Philosophy of Social Ecology: Essays on Dialectal Naturalism (Chico, CA: AK Press, 2022), S. 69; und Isabel Fargo Cole, Das Zenonzän: Paradoxien des Fortschritts (Hamburg: Edition Nautilus, 2025), S. 141–159 ↩
- Andrej Platonov, Dshan oder Die erste sozialistische Tragödie, hg. und übers. Michael Leetz (Berlin: Quintus, 2019), S. 174; Platonov, Frühe Schriften zur Proletarisierung 1919–1927, S. 138) ↩
- Stephen Witt, »Inside the Data Centers That Train A.I. and Drain the Electrical Grid«, New Yorker, 27. Oktober 2025, https://www.newyorker.com/magazine/2025/11/03/inside-the-data-centers-that-train-ai-and-drain-the-electrical-grid ↩
- Murray Bookchin (als »Lewis Herber«), Our Synthetic Environment (1962; rpt. Eastford, CT: Martino Fine Books, 2018); Bookchin, »Towards a Liberatory Technology« (1965), in: Bookchin, Post-Scarcity Anarchism (Oakland, CA: AK Press, 2004), S. 63–64; Herbert Marcuse, »Einige gesellschaftlichen Folgen moderner Technologie« (1941), in: Marcuse, Schriften, Bd. 3 (Springe: zu Klampen, 2004), S. 290–293 ↩
- https://www.ndr.de/hamburger-woche-der-pressefreiheit-gemeinsam-gegen-gezielte-desinformation,pressefreiheit-206.html ↩
- Oliver Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft: Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne (Berlin: Suhrkamp, 2016), S. 17 ↩
- Jurek Becker, Ende des Größenwahns (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1996), S. 85–107 ↩
- Lukács, Der historische Roman, S. 474 ↩
- Becker, Ende des Größenwahns, S. 100 ↩
- László Krasznahorkai, Im Wahn der Anderen, übers. Heike Flemming (Frankfurt/Main: Fischer, ²2025), S. 139 ↩
- Becker, Ende des Größenwahns, S. 87 ↩
- Lukács, Der historische Roman, S. 474 ↩
- Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur, hg. Rolf Tiedemann (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1981), S. 355 ↩
- Krasznahorkai, Im Wahn der Anderen, S. 53 ↩
- Adorno, Noten zur Literatur, S. 356 ↩
- Matthias Ulmer, »Krawalle auf der Messe«, in: Zwischen Zeilen und Zeiten: Buchhandel und Verlage 1825–2025: Eine andere Geschichte des Börsenvereins, hg. Christine Haug und Stephanie Jacobs (Göttingen: Wallstein, ²2025), S. 523 ↩
- Cf. https://moleskinblues.net/2017/10/23/frankfurter-buchmesse-2017/ ↩
- Thomas Mann, »Das deutsche Buch«, in: Mann, Essays II: 1914–1926, hg. Hermann Kurzke, GFKA, Bd. 15.1 (Frankfurt/Main: Fischer, 2002), S. 1051; und Kommentar, GFKA, Bd. 15.2, S. 733; siehe auch Cornelius Pollmer, »Toter Mann über Bord«, in: Zwischen Zeilen und Zeiten, S. 219–220 ↩
- Ernst-Peter Biesalski, »Der Buchtempel«, in: Zwischen Zeilen und Zeiten, S. 450–451 ↩
- Siegfried Kracauer, Die Angestellten (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1971), S. 68 ↩
- George Orwell, Essays (London: Penguin, 1994), S. 29 ↩
- Der deutsche Film, Bd. 7, 1960–1969, hg. Rainer Rother et al. (Berlin: Hatje Cantz Verlag, 2024), S. 68 ↩
- Konstantin Aal, »Die ›Bücherkiste‹ Oase des linken Diskurses im politisch aufgeladenen Deutschland von 2073«, in: Bücherkiste: Eine politisch-literarische Inventur, 1974–2024, hg. Benjamin Bäumer et al. (Siegen: o. V., 2024), S. 210 ↩