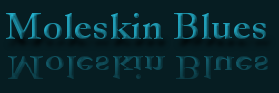Die Schwermut der Vergeblichkeit
Andrej Platonows Roman Die Baugrube liegt in einer deutschen Neuübersetzung vor
Von Jörg Auberg

Als die Große Depression die westliche Welt ergriff, galt vielen das »sowjetische Experiment« als Gegenentwurf zur kapitalistischen Herrschaft. In der westlichen Imagination war dort die Utopie einer anderen, besseren Gesellschaft am Werk. Die Bilder des »sozialistischen Aufbaus« vermittelten sich in Filmen wie Dziga Vertovs Enthusiasmus (1930; dt. Die Donbass-Sinfonie), der noch heute als Meisterwerk des frühen Tonfilms gilt. Mit seiner Montage von Fabriklärm, Pfeiftönen von Lokomotiven und Arbeiterliedern sowie seiner Ästhetisierung der Arbeit im Sinne der »sowjetischen Utopie« verherrlichte er die Industrialisierung eines rückständigen Agrarstaates und die absolute Unterwerfung der Natur unter die rigorose Herrschaft einer »neuen Menschheit«, die letztlich mit einer auf die bloße ökonomische Notwendigkeit reduzierten Blindheit gegenüber dem »Sechstel der Erde« (wie die Sowjetunion in einem früheren Vertov-Film tituliert wurde) geschlagen war.

In einer Szene von Enthusiasmus wird die »Kulturrevolution« propagiert: Während eine Kirche als Sinnbild der alten Welt zerstört wird, zeichnet sich am Horizont schemenhaft das Neue ab. Die »Schatten der Vergangenheit« werden, schrieb Vertov, in einem »revolutionären Sprung« aus der Gegenwart gesprengt und müssen den Akteuren der »neuen Zeit« weichen, den »Pionieren«, »Komsomolzen« und »Funkamateuren«, die »im Radio den Marsch ›Letzter Samstag‹ hören«.1 Der revolutionäre Fünfjahresplan entlädt sich im dunklen Qualm der Fabrikschlote, und im »Rhythmus des sozialistischen Aufbaus« (wie es Owen Hatherley in seinem Buch The Chaplin Machine nennt) werden alle Unterworfenen zu bloßen Elementen tayloristischer Übungen. Im Monumentalprojekt der sowjetischen Modernisierung wandert der Kapitalismus in Form fordistischer Technik durch die Hintertür in den utopischen Raum ein und zerstört den Traum einer besseren Gesellschaft.2
Eine andere Sichtweise auf die sowjetische Realität jener Jahre bietet Andrej Platonows im Jahre 1930 entstandener Roman Die Baugrube, der in der Sowjetunion erst 1987 in der Endphase der Perestroika erscheinen konnte und nun in einer von Gabriele Leupold erstellten Neuübersetzung auch auf Deutsch vorliegt. Im Zentrum des Romans steht der Bau eines gigantischen Turmes, eines »gemeinproletarischen Hauses«, »in dem sich zur lebenslangen glücklichen Ansiedlung die Werktätigen des gesamten Erdballs niederlassen werden«.3 In seiner megalomanischen Dimension ist dieses utopische Projekt jedoch zum Scheitern verurteilt. Zugleich ist es verwoben mit der Zwangskollektivierung der Bauern, die sich am Rand der Baugrube einfinden, um ihre Särge einzufordern, in denen sie ihr Leben beschließen wollen, da ihnen die Existenzgrundlage genommen wurde.
Hauptfigur des Romans ist der Melancholiker Woschtschew, der wegen des Nachdenkens über den »Plan des Lebens« entlassen wurde und als Arbeiter an der Baustelle anfängt, wo er unermüdlich gräbt, ohne dass er auf den »Sinn des Lebens« stößt. Wie Platonow selbst ist er zwischen Utopie und Skepsis gegenüber dem Projekt zerrissen: Einerseits ist er von »Hinfälligkeit einer überlebten Welt« überzeugt, andererseits würgen ihn der »Grützbrei des Kommunismus« oder die »Feuchtigkeit des leeren Ortes«.4
Im totalen, durchaus wohlmeinenden System der Menschheitsbeglückung werden auch die neuen Technologien wie Radio und Film als »soziale Medien« begriffen (»Ich möchte meine Erfahrung teilen«, betitelte Vertov einen seiner Aufsätze aus dem Jahre 1934). Platonow jedoch sieht den Einsatz der »neuen Medien« kritisch: Im Bauprojekt kommt ein Radiotrichter zur ständigen Beschallung der Arbeiter zum Einsatz, der »immerfort wie ein Schneesturm« arbeitet. Ähnlich wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno blieb Platonow gegenüber den »Massenmedien« skeptisch. »Empfehlung wird zum Befehl«, und das Wort geht über in Kommando und Diktat. Am Ende steht schließlich die blanke Herrschaft.5
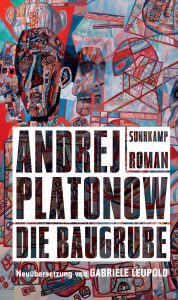
In der Vielschichtigkeit des Textes bleibt die Geschichte Konstruktion und widersetzt sich einer einfachen Darstellung. In der Endfassung ist nur ein Siebtel des ursprünglichen Textes enthalten, schreibt die Übersetzerin Gabriele Leupold in ihrem Nachwort. »Nie darf man kleinlich sein beim Streichen«6, riet Theodor W. Adorno. Bei Platonow wird der Text bis zur Kenntlichkeit verknappt: »so gräbt man Gräber, keine Häuser«7, heißt es an einer Stelle, wobei die Häuser zu Gräbern werden. An einer anderen, parodistisch konnotierten Stelle kontrastiert er die herrschaftliche »Generallinie« mit der Absurdität des »linksradikalen Sumpf[es] des rechten Opportunismus«.8
Zu Recht hebt Leupold hervor, dass die Sprache »der eigentliche Akteur im Roman – und eine Herausforderung für die Leser« sei.9 Bereits der Anfang des Romans beschwört in seiner sprachlichen »Eigentümlichkeit« die Besonderheit der historischen Situation. »Am dreißigsten Jahrestag seines persönlichen Lebens gab man Woschtschew die Abrechnung von der kleinen Maschinenfabrik, wo er die Mittel für seine Existenz beschaffte.«10 Im scheinbar utopischen Raum des »sowjetischen Experiments« müssen die Individuen, die keine Individuen mehr sein dürfen, den Nachweis erbringen, ob sie nützlich für die Welt sein könnten oder ob diese »glücklich« ohne sie auskäme. In seiner restlos bürokratischen Version käme der Sozialismus ohne sie aus, und sie würden »krepieren«, geben die offiziellen Vertreter des Systems zu Protokoll. Dass sie damit die gesamte Idee einer besseren und gerechteren Gesellschaft ad absurdum führen, ist ihnen nicht bewusst, da sie das Denken im Sinne einer gedankenlosen Ideologie längst aufgegeben haben. Der Melancholiker Woschtschew verwahrt zwar im Geheimfach seines Sackes »alle möglichen Unglücks- und Vergessenheitsdinge«11, doch hilft ihm dies auch nicht, gegen das triumphierende System anzukommen. Es dominieren »die allgemeine Traurigkeit des Lebens und die Schwermut der Vergeblichkeit«12.
Leider ruiniert der Verlag diese verdienstvolle Neuübersetzung, zu der Gabriele Leupold ausführliche Anmerkungen zum historischen Verständnis des Textes beisteuert, mit einem überflüssigen Nachwort der Suhrkamp-Hausautorin Sibylle Lewitscharoff, die sich vor allem mit narzisstischen Bekenntnissen in den Vordergrund rückt – »Ich wurde mit dem Roman bekannt, als …« oder »Ich kenne keinen anderen Roman …« –, ohne dass sie in der Lage wäre, auch nur einen originären Gedanken zu produzieren. Stattdessen traktiert sie die Leser mit Formulierungen wie »Entschuldigungsgemurmel«, »verfilzte Komik« oder »Heiterkeitsfrösche«.13

Dagegen bietet die konzise und fundierte Platonow-Monografie des Slawisten Hans Günther eine nützliche Einführung zum Werk Platanows. Im ersten Teil liefert er einen biografischen Abriss, während er im zweiten Teil detailreich das prosaische und dramatische Werk Platonows vorstellt. Ein Überblick über die Wirkung des Werkes Platanows nach seinem frühen Tod im Jahre 1951 und eine ausführliche Bibliografie runden diesen überaus nützlichen Band ab. Obwohl Platonow sich nie vom »sowjetischen Projekt« distanzierte, katapultierte ihn dennoch seine kritische Standfestigkeit in ein »Leben im Schatten«14, wie Günther schreibt. Am Ende führte er eine nur noch am Rande der sowjetischen Literatur geduldete Existenz. Dennoch überdauerte er die Zeit als einer der wichtigsten Autoren dieser Epoche.
Bibliografische Angaben:
Andrej Platonow.
Die Baugrube.
Aus dem Russischen übersetzt, mit Kommentaren und einem Nachwort versehen von Gabriele Leupold.
Mit einem Essay von Sibylle Lewitscharoff.
Berlin: Suhrkamp Verlag, 2016.
240 Seiten, 24,00 EUR.
Hans Günther.
Andrej Platonow: Leben – Werk – Wirkung.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2016.
148 Seiten, 14,00 EUR.
| Bildquellen (Copyrights) |
|
| Szenenfotos Dziga Vertov: Die Donbass-Sinfonie | Archiv des Autors |
| Cover Andrej Platonow: Die Baugrube | © Suhrkamp Verlag |
| Cover Hans Günther: Andrej Platonow | © Suhrkamp Verlag |
Eine kürzere Fassung erschien in literaturkritik.de, Nr. 3 (März 2017)
© Jörg Auberg 2017
Nachweise
- Dziga Vertov, zitiert in: Die Donbaß-Sinfonie (Enthusiasmus), Internationales Forum des jungen Films, Berlinale 1972, hg. Freunde der deutschen Kinemathek ↩
- Owen Hatherly, The Chaplin Machine: Slapstick, Fordism and the Communist Avant-Garde (London: Pluto Press, 2016), S. 144–154 ↩
- Andrej Platonow, Die Baugrube, übers. Gabriele Leupold (Berlin: Suhrkamp, 2016), S. 28 ↩
- Platonow, Die Baugrube, S. 58, 65, 91 ↩
- Platonow, Die Baugrube, S. 64; Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov, hg. Annette Michelson (Berkeley: University of California Press, 1984), S. 119–123; Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, »Dialektik der Aufklärung«, in: Horkheimer, Gesammelte Schriften, Band 5, hg. Gunzelin Schmid Noerr (Frankfurt/Main: Fischer, 1987), S. 187 ↩
- Theodor W. Adorno, Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1987), S. 105 ↩
- Platonow, Die Baugrube, S. 23 ↩
- Platonow, Die Baugrube, S. 157 ↩
- Gabriele Leupold, »Am Proletariat herrscht heute ein Manko oder Wie die Baugrube gemacht ist«, in: Platonow, Die Baugrube, S. 226 ↩
- Platonow, Die Baugrube, S. 7 ↩
- Platonow, Die Baugrube, S. 11 ↩
- Platonow, Die Baugrube, S. 19 ↩
- Sibylle Lewitscharoff, »Gefährliche Lektüre«, in: Platonow, Die Baugrube, S. 232, 233, 238 ↩
- Hans Günther, Andrej Platonow: Leben – Werk – Wirkung (Berlin: Suhrkamp, 2016), S. 46 ↩